Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtung soll der durch Stellvertreter geführte Dialog stehen, in dem diese eine sehr kleine Teilmenge der von den Auswirkungen des Dialogs Betroffenen, darstellen, also nicht mit ihnen ident sind: Um als (berechtigter) Stellvertreter zu gelten, muss man durch die Betroffenen qua Amt, qua Wahl oder auf irgendeinem anderen Weg legitimiert worden sein; diese Legitimation wird immer von Einzelnen oder Gruppen in Frage gestellt werden, der Dialogs wird Angriffen ausgesetzt sein, gegen die sich die beteiligten Personen behaupten müssen; ihre Kraft erhält diese Behauptung aus der Notwendigkeit des Dialogs und der Nachteile (»Kosten«) die ein Scheitern oder Nichtzustandekommen bedeuten würden.
Mutterliebe, Charakterumkehr und kurze Panik
TAGEBUCHAUFZEICHNUNGEN MÄRZ 1989
Paris, 6. März, Montag: Strahlender Tag, herrliche Wärme, unglaublich schön. Mutter klingt schrecklich schlecht, am Telefon, in Berlin ist sie, alleingelassen von Bob1, ent-liebt, deprimiert. Mache ihr den Vorschlag, nach Paris zu kommen. Aus Mitleid? Ja, in erster Linie.
Begleite L.2 zu ihrem Engagement in den »Vogue«-Studios: sie soll Limonov3 nackt photographieren, für die Condé-Nast-Zeitschrift »Glamour«. (...) Durch die unfassbare Wärme Richtung Théatre de l’Odéon, heute gelingt mir der erste Kontakt zu den Männern.4 Ein Junge spricht mich an, Pascal, stellt mich all seinen Haberern5 vor, Hakim vor allem, einem Wasserfall der Rede- und Erzähllust. Lade sie zu Café und Menthe-Tee ein, wir sprechen über mein Anliegen, sie zeigen sich interessiert, begeistert, neugierig. Hakim meint, ich müsse viel über die Technik des Bühnenbilds, der Bühnenarbeit nachlesen, die zahllosen Fachausdrücke, die Knoten, die TABUS der »machinistes« kennenlernen, die vor 200 – 300 Jahren meist ehemalige Seeleute waren. Er zeigt mir den Bereich oberhalb der Bühne, den Schnürboden sozusagen, CINTRE genannt. Bin im Umkleideraum der Männer, wo die blau-metallenen Schränke stehen – wie bei Fußballern oder Militärs. Endlich der erhoffte Kontakt! Werde sicher viel von diesen Kerlen lernen...
Gemeint sind Jungks Eltern, Ruth und Robert (Bob) Jungk. ↩
Lillian Birnbaum, Fotografin und Filmproduzentin, seine spätere Frau. ↩
Ed Limonov, russischer Schriftsteller, später nationalistischer Politiker. Vgl. 'Horror-Wohnungen' ↩
Im Rahmen seiner Recherchen für den Roman 'Tigor', 1991 im Verlag S. Fischer erschienen, verbrachte Jungk mehrere Monate im Théatre de l’Odéon, um das Leben der Bühenarbeiter, vor allem der am Schnürboden Beschäftigten, näher kennenzulernen. ↩
Österreichisch/Wienerisch für Freunde. ↩
Die Grausamkeit der Vernunft
Karl Gutzkow: Wally, die Zweiflerin Jesus war ein »Schwärmer«, der eine »verunglückte Revolution« anzettelte. Sich als Messias zu bezeichnen, war eine »dreiste Behauptung«. Die Jesus-Geschichten in der Bibel sind »Märchen«, die nur von Ochsen und Eseln – wie im Stall von Bethlehem – geglaubt würden... Wer heute solche Sätze über den Propheten Mohammed und den ...
Neues Ressort: »Wiedervorlage«
Leopold Federmairs morgiger Beitrag »Die Grausamkeit der Vernunft« über Karl Gutzkows Buch »Wally, die Zweiflerin« begründet ein neues Ressort auf dieser Webseite. Es heisst »Wiedervorlage«. In loser Folge sollen hier persönliche Eindrücke wiedergegeben werden, die beim Wiederlesen eines Buches oder vielleicht erneutem Anschauen eines Filmes oder eines anderen Kunstwerkes entstanden sind. Wie hat sich das ...
George Packer: Die Abwicklung
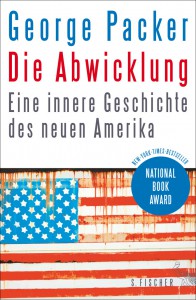
Was ist »Abwicklung«? Es ist, so Packer, die »Abwicklung der Normen«, das, was man Deregulierung nennt, was zu einem Zurückentwickeln des Mittelschichtversprechens der USA führt. Und mit ihm verschwindet die institutionelle Kultur der Demokratie der Mittelschicht, die einmal so kongenial beschrieben wird: »General Motors, der Gewerkschaftsbund AFL-CIO, der ständige Ausschuss für Arbeitsbeziehungen, der Chef in der Stadt, Bauernverbände, die Bezirksverbände der Parteien, die Ford-Stiftung, der Rotary Club, die Frauenliga, CBS News, der ständige Ausschuss zur wirtschaftlichen Entwicklung, die Sozialversicherung, das Amt für Bodenschätze, das Bau- und Wohnungsamt, das Gesetz zur Schaffung des Autobahnnetzes, der Marshall-Plan, die NATO, der Rat für internationale Beziehungen, das Studienförderungsgesetz für Veteranen, die Armee.« Allgemein nennt man so etwas »Gesellschaftsvertrag«. Das Versprechen: Harte und ehrliche Arbeit bedeutete ökonomischen Wohlstand und adäquate Partizipation an und in der Gesellschaft, so das Ideal. Stattdessen ging die berüchtigte Schere immer weiter auseinander. An Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey, Peter Thiel oder Sam Walton skizziert Packer die Ausnahmen: Sie wurden zu Milliardären, obwohl die Voraussetzungen auch hier nicht immer gut waren.
Wie man sich von sich selbst befreit
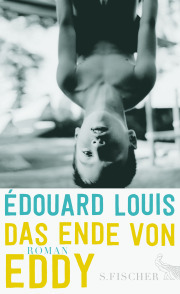
Das Ende von Eddy
Édouard Louis hieß ursprünglich Édouard Bellegueule, und gerufen wurde er »Eddy«. So steht es im autobiographischen Roman, den der Autor 2012 in Paris veröffentlichte, und auch in der Wirklichkeit verhält es sich so. »Schönmaul«, mit diesem Namen ist das Kind gestraft; die entsprechenden Wortspiele werden gleich zu Beginn des Romans zitiert. Édouard Louis, 22, hat sich von den Fesseln seiner Herkunft befreit, indem er dieses Buch schrieb. Die Befreiung hat auch einen finanziellen Hintergrund, denn der junge Autor entstammt einer Schicht, die man als neues Lumpenproletariat bezeichnen könnte, und sein Erstling war in Paris ein Bestseller. Die Vorgeschichte seiner Befreiung kann man in Das Ende von Eddy nachlesen. Schon der Titel weist darauf hin: Eddy Bellegueule gibt es nicht mehr. Die Niederschrift und Veröffentlichung des Romans ist gleichbedeutend mit seiner Vernichtung.
En finir avec Eddy lautet der Titel im Original. Hinrich Schmidt-Henkel, ein außerordentlich gewandter Übersetzer, der viele sprachliche Register zu ziehen versteht, bildet den von Louis häufig zitierten nordfranzösischen Soziolekt geradezu lustvoll nach – beim Titel scheint er mir aber etwas schmähstad gewesen zu sein (oder hat ihn ein Lektor behindert?). »Schluß mit Bellegueule« würde passen und käme dem Original näher. Die Erzählung selbst hat etwas Gewalttätiges, nach dem Selbstverständnis des Autors handelt es sich um Gegengewalt gegen das gewalttätige System. Die davon Betroffenen und (im Buch) Beschriebenen beziehen die literarische Gewalt aber auf sich selbst: Der will uns vernichten! Mitsamt seinem Eddy will Louis auch die Umgebung zerstören, in der er aufgewachsen ist, also die konkreten Menschen im Dorf Hallencourt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Literatur gegen Verrohung. Verrohung gegen Literatur, gegen die Schwulen, gegen die Weicheier.
Fritz J. Raddatz
Fritz J. Raddatz ist tot. Wirklich? Oder ist es nur Spiel von ihm, die heuchlerischen Nachrufe für ein neues Buch zu sammeln? Man kennt das von Kindern, die sich nicht genügend geliebt fühlen und dann erleben möchten, wie Eltern und Freunde sie auf ihrer Beerdigung beweinen. Die Lektüre der Tagebücher von Raddatz vermittelte mir einen ...
Marc Degens: Fuckin Sushi

Niels hat einen Bass. René eine Gitarre und Ideen für Texte, die »roh und hart und ehrlich« sind. Beide gründen eine Band: »R@’n’Niels« (René ist R@ = »rat«). Eines Sonntags fahren sie, um sich in Bonn nicht zu blamieren, nach Bad Münstereifel und spielen dort vor dem Heino-Café. Der Erfolg ist überschaubar, aber die Saat keimt. René gelingt es, den sechs Jahre älteren Lloyd zu begeistern. Von nun an haben sie einen Schlagzeuger und Fahrer in Personalunion. Vor allem jedoch einen Probenraum – in einem Turm. Später kommt noch die Punkerin Nino mit ihrem Keyboard hinzu. Aus dem Bandnamen »Funking Sushi« wird schließlich »Fuckin Sushi«. Es geht um »Weltfrieden und Abrentnern«. Die Logik ist verblüffend: Warum nicht nach der Schule mit der Rente beginnen, Musik machen, tagsüber Fernsehen (»Kochsendungen, Zooreportagen, Hallenfußball oder Sommerbiathlon«) und erst dann, so ab 50, mit dem Arbeitsleben beginnen?
