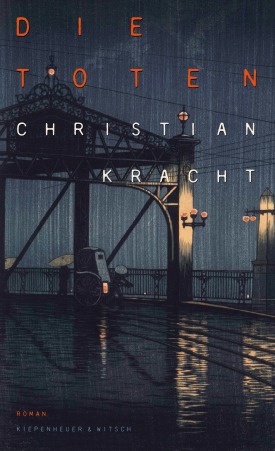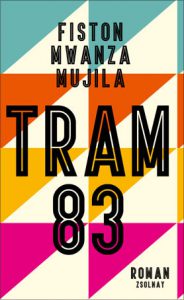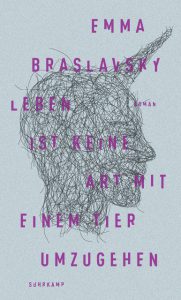Wie alt mag sie wohl sein? Die Zahl Hundert ist für uns, die wir so weit davon entfernt leben, wie ein Tor zu einer mythischen Landschaft. Etwa so, als müßte man, wenn man da einmal durch ist, nicht mehr sterben. Unter dem dünnen kastanienfarbenen Haar der kleinen, buckeligen Frau scheint die weiße Kopfhaut durch. Ihre Hände schieben entschlossen kontrollierend die Waren auf dem Ladentisch zusammen, während ihr Mund das unveränderliche Gespräch mit der Verkäuferin führt. Karg, denkt der Beobachter aus der realen Welt; ärmlich. Dinge, die wir nicht kaufen, die wir nicht einmal sehen im Regal, winzige Fläschchen mit Gesundheitsgetränken, eine einzelne, abgepackte Banane, die später in drei Stücke, drei Tage geteilt wird. Draußen, neben der Eingangstür, hat die Hundertjährige ihr Fahrzeug abgestellt: Koffer, Thron und Rollator in einem. Die Frau stellt die weiße Konbiniplastiktüte auf dem Asphalt ab, klappt den Deckel (die Sitzfläche) hoch, holt (zaubert) allerlei Tücher und Beutel hervor, entfaltet zwei oder drei davon, legt (zaubert) die anderen zurück und beginnt mit raschen, energischen Handgriffen den Einkauf zu ordnen, die Waren auf zwei oder drei Beutel zu verteilen. Woher diese Energie? Und was für eine Art von Energie? Wie mag sich das Treiben anfühlen in der mythischen Welt? Oder ist es nur Ökonomie, sparsamster Umgang mit der vorhandenen Energie, den Ressourcen? Dabei besteht das jetzt der Glasfront und der grellen, scharf umrissenen, stets neuen und alterslosen Welt zugewandte, zugleich abgewandte Gesicht nur aus zwei breiten weißen Lappen mit kaum geöffneten Seh- und Atemschlitzen. Der Deckel im Handumdrehen zugeklappt, der Einkauf ist verteilt und verstaut, auf den weißen Lappen lesen wir Zufriedenheit (aber die lesen wir hinein, weil wir die Ausdruckslosigkeit nicht ertragen). Abgewetzt, abgesessen, an den Ecken abgestoßen und abgerundet ist das Gefährt der Frau, die es jetzt mit langsamen und energischen Schritten umrundet, um es schließlich an der horizontalen Haltestange, die als Stütze und Steuer dient, zu packen. Sie richtet sich auf; rundet sich ab; der Buckel wölbt sich über den Thron mit dem unsichtbaren – ich weiß nicht, ob König, Ehemann, Bettelmann, Nichts. Entschlossen durchstößt die Frau die Grenze unseres Gesichtsfelds, das seine bemessene Realität wiedergewinnt.
Blick ins Nobel-Archiv
Die teilweise heftigen Diskussionen um die jüngste Vergabe des Literaturnobelpreises an Bob Dylan zeigen, dass der Preis immer noch eine gewisse Strahlkraft hat. Ansonsten würden sich die Emotionen nicht derart hochschaukeln. Wenig Beachtung findet dabei, dass die Schwedische Akademie jedes Jahr ein kleines bisschen ihr Archiv öffnet. Mit dem je nach Temperament wohltuenden oder obsolet-hinhaltenden Abstand von 50 Jahren werden die Nominierungen zu den Nobelpreisen veröffentlicht. Das Finden auf der Webseite ist etwas kompliziert. Hat man sich aber erst einmal eingegroovt, wird man mit interessanten Erkenntnissen belohnt.
Derzeit gibt es Zugriff auf die Nominierungslisten zu den Nobelpreisen von 1901 bis 1965. Die Suche kann leicht sowohl über den Namen als auch über das Vergabejahr durchgeführt werden. Insgesamt waren bis dahin 3005 Nominierungen für den Literaturnobelpreis eingegangen. 1901 lagen 37 Nominierungen vor, 1965 waren es bereits 90. (Die Zahl ist inzwischen deutlich höher.) Ein Blick auf die Listen zeigt, dass neben Einzelvorschlägen auch Sammelnominierungen mehrerer Persönlichkeiten für einen Kandidaten gab, die allerdings nur einmal gezählt wurden. Studiert man die Listen genau, so gab es keine Garantie für den »Unterlegenen« bei einer der nächsten Preisvergaben berücksichtigt zu werden.
Weiterlesen
Leucht/Wieland (Hrsg): Dichterdarsteller
Seit Roland Barthes in den 1960er Jahren den »Tod des Autors« verkündete, galt es lange Zeit in den Literaturwissenschaften als verpönt, Werk und Vita des Autors in Zusammenhang zu bringen. Erst in den letzten Jahren wurde dieses nahezu wie ein Tabu behandelte Diktum aufgegeben und wieder vermehrt die Frage nach Interdependenzen zwischen dem Leben eines Autors und dessen Werk gestellt. Die Enthüllung um das Pseudonym von Elena Ferrante zeigen, wie wichtig es inzwischen zu sein scheint, ein Werk direkt mit der Autorin zu verknüpfen. Insofern überrascht es, dass im Feuilleton die Demaskierung bisher mehrheitlich abgelehnt wird.
Robert Leucht und Magnus Wieland, die Herausgeber des im Frühjahr erschienenen Buches »Dichterdarsteller – Fallstudien zur biographischen Legende des Autors im 20. und 21. Jahrhundert«, erklären diese Tendenz vor allem aufgrund der steigenden Bedeutung der sozialen Medien, in denen Personalisierungseffekte forciert werden. Parallel ist allerdings seit geraumer Zeit ein starker Hang zum biographistischen Lesen im deutschsprachigen Feuilleton zu erkennen.
Leucht und Wieland nehmen sich mit ihrem aktuell herausgegebenen Band dem ewigen Widerstreit zwischen biographistischer und puristischer, ausschließlich auf den jeweiligen Text konzentrierter Lesart, an und machen mit der Wiederentdeckung der »biographischen Legende« einen Versuch, die beiden literaturwissenschaftlichen Lager zu versöhnen. Die »biographische Legende« ist ein Begriff des russischen Literaturwissenschaftlers Boris Tomaševskij aus dem Jahr 1923. Die beiden Herausgeber des Buches stellen diese lange vergessene These in einer detailreichen Einleitung vor. Die biographische Legende wird dabei als Abgrenzung zum empirischen Autor als Konstruktion hin zum Werk interpretiert und aber auch distanzierend zur Autorenfigur des literarischen Textes betrachtet. Sie ist somit eine dritte auktoriale Instanz; sozusagen »zwischen« der realen Vita des Autors und dessen Werk.
Christian Kracht: Die Toten
Wie schon in »Imperium« werden in »Die Toten« historische Persönlichkeiten von Christian Kracht mit fiktiven Handlungen und Charakteren zusammengebracht; ein Genre, das mit »Doku-Fiction« oft nur unzulänglich bezeichnet und keinesfalls eine Erfindung von Kracht ist, sondern längst aus dem Fernsehen abgeschaut von zahlreichen zeitgenössischen Autoren praktiziert wird. So tritt in diesem Roman an zentralen Stellen Charlie Chaplin auf (den Kracht natürlich »Charles Chaplin« nennt) – und dies durchaus nicht schmeichelhaft. Auch andere historische Persönlichkeiten wie beispielsweise Alfred Hugenberg, Ernst Hanfstaengl, Heinz Rühmann, Siegfried Kracauer und Lotte Eisner werden wie selbstverständlich in die Geschichte um die fiktiven Hauptpersonen, den Schweizer Filmregisseur Emil Nägeli, den japanischen Ministerialbeamten Masahiko Amakasu und Ida von Üxküll, Nägelis Verlobten, eingebaut. Merkwürdig bei Ida ist die Vermischung zwischen fiktiver und realer Person. Es hat tatsächlich zwei Frauen gegeben, die diesen Namen trugen, aber sie passen nicht in die Biografie der Romanfigur, die um 1905 herum geboren ist (zum einen Ida Gräfin Üxküll-Gyllenband, geb. Freiin von Pfaffenhofen-Chledowski [1887–1962], die Frau des 1944 hingerichteten Widerstandskämpfers Nikolaus Graf Üxküll-Gyllenband und zum anderen eine gewisse Ida von Uexkuell Gyllenband [1837–1920], die tatsächlich in Los Angeles gestorben sein soll). Warum Kracht wohl derart verfährt?
Am Ende seines Lebens wird der Schweizer Regisseur Emil Nägeli sagen, dass es in einhundert Jahren Kino lediglich fünf Genies des Kinos gegeben habe – Bresson, Vigo, Dowshenko, Ozu und er selbst. Es gehe diesen Regisseuren, so der allwissende Erzähler, »nicht nur um die Unmöglichkeit, die Farbe Schwarz darzustellen, sondern auch um das Aufzeigen der Anwesenheit Gottes«.
C 12
Nach Kaffee und Schokoladeneis mit Sahne bei de Marco (wie immer) weiter durch Eicken, meinem Kindheitsviertel, seit Jahrzehnten verkehrsberuhigt und längst ökonomisch sterbenskrank, so viele Läden, die geschlossen sind, einige seit Jahren, teils trotzig mit ihren zugeklebten Scheiben oder diesem uralten, verrosteten Rollgitter vor dem einstigen Optikergeschäft, dessen Brillen ich heute sehr selten noch als Ersatz für den Ersatz verwende. An der Sparkasse links abgebogen auf die Schwogenstrasse, wo einst M. sein Haus hatte, jener M., der im Frühjahr starb und in der Todesanzeige hatte ich zum ersten Mal seinen Jahrgang gelesen (er war 26 Jahre jünger als mein Vater) und den Spruch von der »liebevollen Fürsorge«, der da verwendet wurde, war derart geheuchelt, dass mir übel wurde; ihm, diesem Fremdgänger und Choleriker wurde im Tod ein Denkmal der familiären Tugend errichtet und da erinnerte ich mich an seine herrische Art, mit der er meinen Vater kommandierte und die Verachtung, die ich meinem Vater dafür zollte, dass er sich derart kommandieren ließ und nur ganz kurz, als ich nach der Schule keine Lehrstelle bekommen hatte und arbeitslos war, »arbeitete« ich für M., analysierte die wöchentlich erscheinenden »Rennkalender«, extrahierte bestimmte Daten von Pferden und Trainern aus diesen Listen, die ich ihm dann aufbereitete und als dieses oder jenes dann ergebnisrelevant war, beschimpfte er mich, warum ich ihm das nicht gesagt hatte, dabei hatte ich es gesagt aber nur einmal und dann auf meine Aufzeichnungen verwiesen und grob fuchtelnd wehrte er ab, das »Geschreibsel« habe er doch nicht gelesen oder sofort wieder vergessen, ich müsse es ihm sagen, mehrmals, immer wieder und in der nächsten Woche sagte ich ihm die Auffälligkeiten und er richtete sich mit seinen Wetten danach, aber nichts traf zu und er schimpfte wieder und dann ich hörte auf, nahm die 50 Mark für die zwei Wochen und von nun an versuchte ich, ihn wie Luft zu behandeln. Weiterlesen
Fiston Mwanza Mujila: Tram 83
Irgendwo in Afrika, in einem Land, das sich Demokratische Republik Kongo nennt (und vorher Zaire nannte), vielleicht in einer Stadt in der Provinz Katanga, die hier »Stadtland« heisst, einer Stadt oder einem Gebiet, das sich von »Hinterland« abgespalten hat, denn in Stadtland gibt es Steine und diese Steine beinhalten Erze und vor allem Kupfer und das verspricht Reichtum, aber dieses Versprechen gilt nicht für jeden und am Ende kommt es nur noch darauf an, ob man auf der organisierten oder desorganisierten Seite der Bananenrepublik lebt. Dort gibt es das »Tram 83«: Kaschemme, Bar, Imbiss, Jazzclub, Bühne, Tanzpalast, Bordell, Drogenhöhle, Geldwaschanlage, 24 Stunden geöffnet, eine Mischung aus Berghain, Cotton Club, Sodom und Gomorrha, Hieronymus Boschs »Sieben Todsünden« und dem »Weltgericht«, Kirche und Moschee, ein Ort, der fasziniert und abstösst, Treffpunkt für Grubenarbeiter, Studenten, »Touristen«, Dealer, Literaten und Verleger, Frauen, die nach »Küken«, »Single-Mamas« und »Ex-Single-Mamas« und, vor allem, nach Form und Größe ihrer Brüste unterteilt werden, Geschäftsmänner, Zuhälter, Gläubige und Atheisten, Korrupte und Moralisten. Zu Beginn fällt einem noch eine Goldgräberromantik aus den USA ein, aber das wird einem hier schnell ausgetrieben, denn hier herrschen Sex und Geld und ein Frauenüberschuss, da Bürgerkriege noch nicht lange zurückliegen.
Zu Beginn kommt Lucien ins »Tram 83«, ein Schöngeist mit Notizbuch, der ein Bühnen-Epos nach Paris abliefern soll. Er trifft seinen Freund Requiem, genannt »Negus«, einem auf den ersten Blick Kleinkriminellem, der immer unsympathischer wird, sich als Kriegsverbrecher (ein Pleonasmus?), Bandenführer, Plünderer, Vergewaltiger, Erpresser und Schmuggler entpuppt, der Filme mit Jean Gabin und Lino Ventura mag. Irgendwann gibt es noch den Schweizer Verleger Ferdinand, der Gefallen an Luciens Texten findet, aber schließlich von Requiem mit Bildern von ihm und der (minderjährigen) Prostituierten erpresst wird. »Was sagt die Uhr« ist der Standardsatz, den man stellenweise auf fast jeder Seite des Buchs findet. »Was sagt die Uhr« fragt die Meute für die Muße ein Verbrechen ist. Alles ist vulgäres Business (vor allem der Sex), selbst die Kellnerinnen drangsalieren die Gäste zum Trinkgeld und für die Prostituierten gilt die (Schach-)Regel: »berührt-geführt«. Weiterlesen
Emma Braslavsky: Leben ist keine Art mit einem Tier umzugehen
Der Deutsch-Argentinier (oder Argentinien-Deutsche) Jivan Haffner Fernández ist Bunkerarchitekt, Anfang 40 und lebt in Berlin. Er ist verheiratet mit der 39jähigen Jo Lewandowski Fridman. Jivan braucht Geld, die Geschäfte gehen schlecht und er hat immense Spielschulden, denn sein Hobby ist Online-Poker. Auch Jos Aktivitäten zeichnen sich dadurch aus, dass sie Geld kosten und wenig bis nichts einbringen. Sie ist eine »Bessere-Welt-Aktivistin«; vermutlich zunächst auf Basis dessen, was man Ehrenamt nennt. Im Laufe des Romans »Leben ist keine Art mit einem Tier umzugehen« durchläuft Jo das Casting aller wichtigen, multinationalen Weltrettungsorganisationen, die auf diesem Planeten nicht mehr so ganz einflusslos sind.
Denn Emma Braslavskys Buch spielt in einer Zukunft, die von allen politischen und sozialen Unruhen gereinigt scheint. Es muss um das Jahr 2050 sein, in Lublin ist gerade der zehnmilliardste Mensch geboren worden. Die Vereinten Nationen haben mehr oder weniger die Durchsetzungsmacht übernommen, obwohl die Nationalstaaten weiter existieren. Auf dem Markt der Idealisten konkurrieren keine Kirchen mehr mit- oder gegeneinander, sondern weltweit vor allem zwei Organisationen: »BetterPlanet« und »Life from Zero«. Diese liefern sich einen erbitterten Kampf um Mitglieder und vor allem Geldgeber. Zu Beginn möchte Jo Pressesprecherin der multinationalen Tierrechtsorganisation »Animal for Rights« werden (»der Mensch ist laut Satzung der Organisation ‘ein böses Tier‘«) und trifft sich hierzu mit den beiden Gründern in einem – selbstredend – veganen Restaurant. Auch Jivan stößt dazu; er hatte sich etwas verspätet, weil er zum einen noch einen Döner bei seinem Freund Ediz gegessen hatte und zum andern seine alte Ledertasche noch verstecken musste, um keinen Argwohn bei den Tierrechtlern zu erregen.
Die Heucheleien gelingen Jivan prächtig. Zwischen »Reismilch-Salbei-Kümmel-Brühe« und »auf Palmenblättern gegrilltes Pilzassortment« unterbreitet Jivan den tatsächlich ernsthaft diskutierten Vorschlag, wonach Menschen und Tiere künstliche Einhörner tragen sollten (daher das Cover). Es ist gekonnt und vergnüglich, wie Braslavsky dieses Szenario in einer Mischung aus Loriot und Joachim Zelter inszeniert und der Leser bekommt einen Vorgeschmack auf Jos Ehrgeiz und Vitalität, auch noch den größten Unsinn in ihre Weltrettungspläne mindestens ins Kalkül zu ziehen. Weiterlesen
Possenspiele
»Ich bin psychisch stabil«, sagt die Schriftstellerin Michelle Steinbeck in einem Interview mit dem Schweizer »Tagesanzeiger«. Ein merkwürdiges Statement, aber es ist fast schon erzwungen, da die Hilde Benjamin der deutschen Literaturkritik, Elke Heidenreich, wieder einmal einen ihrer Aussetzer hatte und im letzten »Literaturclub« der Autorin eine »ernsthafte Störung« attestierte – und dies einzig alleine, weil ihr, Heidenreich, das Buch von Steinbeck (»Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch«) nicht gefällt.
Heidenreich entwickele sich zu einer Hypothek für den »Literaturclub« stellte dann auch Guido Kalberer im »Tagesanzeiger« fest. Die Liste der Heidenreich-Eskapaden sind längst Legion. Aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind, steht und stand die Redaktion zu ihr. Als sie mit Stefan Zweifel aneinandergeriet, weil sie ein falsches Zitat verwendete, musste nicht sie gehen, sondern Zweifel. Die Grandezza, mit der sie neulich diesen Vorgang verdrehte, muss man erst einmal nachmachen.
Allgemein wurde das Statement von Steinbeck als besonnen und richtig bezeichnet. Die Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs an sich ist dabei irgendwie unter die Räder gekommen: Müssen demnächst SchriftstellerInnen auf Mutmassungen von sogenannten Kritikern mit ärztlichen Attesten reagieren? Weiter gesponnen: Muss ein Kriminalroman-Autor demnächst prophylaktisch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, das er/sie nicht selber gemordet hat? Weiterlesen