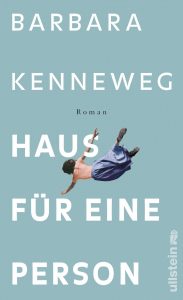Es sind in neuerer Zeit nicht eben viele Autoren, aus deren Schriften hervorgeht, daß Jacob Böhme für sie einmal irgend von Bedeutung gewesen ist, und von denjenigen der Gegenwart gilt das am augenscheinlichsten gewiß für Peter Handke. Dabei handelt es sich in seinen Erzählungen und Aufzeichnungen meist um eher knapp gehaltene assoziative Bezugnahmen – mitunter, wie in der Morawischen Nacht, bleibt es bei einer einzigen im Text.1 Auf gleich eine ganze Reihe von solchen Hinweisen stößt man dagegen in seiner Sammlung von Notizen aus den Jahren 2007–2015, die 2016 unter dem Titel Vor der Baumschattenwand nachts2 von ihm veröffentlicht wurden. Daß ich mich im folgenden speziell auf sie ein wenig genauer einlassen möchte, bedarf, mit Blick auf den Rahmen, in dem dieser Text zu stehen kommt, sicher keiner besonderen Erklärung; angesichts der Vielfältigkeit der von Handke notierten Gedanken und Beobachtungen erscheint eine Beschränkung im Stoff ohnehin unumgänglich. Ein wenig mehr vom Ganzen als nur der gewählte schmale Ausschnitt wird sich auch auf diese Weise aber dennoch beleuchten lassen.
Die insgesamt mehrere tausend »Zeichen und Anflüge«, wie es im Untertitel heißt, umfassende Sammlung von Kurztexten ist nach der Chronologie ihrer Entstehung oder Niederschrift angeordnet. Ein Großteil von ihnen läßt sich dabei unter zweierlei Rubriken einordnen, zum einen: Die umgebende Natur im Wechsel der Jahreszeiten, und zum andern: Gedanken zu Gelesenem (oder Verweise auf Gelesenes), wodurch sich im Verlauf des Buchs ein recht genaues Bild ergibt (oder vielleicht auch nur zu ergeben scheint) über die Lektürefolge in den Jahren zwischen 2007 und 2015. So finden sich über längere Zeit Verweise auf, Zitate aus den Tagebüchern von John Cheever, später begegnet immer wieder der Name Paul Nizon, noch später (u. a.) die »Brüder Karamasow«. Gegen Ende sind es dann vor allem die Zeugnisse zum Leben Goethes, die Handke in ihren Bann ziehen; als er, im Februar 2015 wohl, bei dessen Tod angekommen ist (»›Er suchte die göttliche Ruhe in sich herzustellen‹ [(Riemer von G., nach dessen Sterben])« (334), beginnt er (»›Ich habe euch gar zu lieb, siehe, ich schreibe bei Nacht für euch‹ [G. an seine Schwester, 1765 […]]« wieder »von vorne« (336) mit ihm. Und aus dieser Lektüre der Briefe und anderen Lebenszeugnisse ist im übrigen auch die dem Buch vorangestellte Widmung genommen: der »Koppenfelsische[] Scheunengiebel« stammt, wie man auf einer der letzten Seiten erfährt, aus einem Brief an Zelter aus dem Jahr 1816 (411).
Eine eigene Abteilung innerhalb der Aufzeichnungen zu Literarischem bilden die Kommentare zu und Zitierungen von Autoren, die für gewöhnlich dem Bereich der Mystik zugerechnet werden. Das gilt, besieht man sich die Häufigkeit der Nennungen, im besonderen Maße für solche des muslimisch-arabischen Raums: Ibn ʿArabī, Al-Ghazali und Al-Minhadj (u.a. 26, 48, 83f., 94); aus dem Bereich der christlichen Mystik werden je einmal Mechthild von Magdeburg (152) und Juan de la Cruz (255) von Handke zitiert, und, als ein Mystiker der besonderen Art, weil einer aus unserer Zeit, und er wieder gleich mehrmals, der »Mystiker Carlfriedrich Claus« (288), »der Zeichner, der Maler« (295), während in Opposition zu ihnen allen Goethe erscheint, »entschlossener Anti-Mystiker – aber im ›Großen Krieg‹ zugleich gegen sich selber?« (343). Weiterlesen