Aus traurigem Anlass:
Caroline Wahl: Die Assistentin
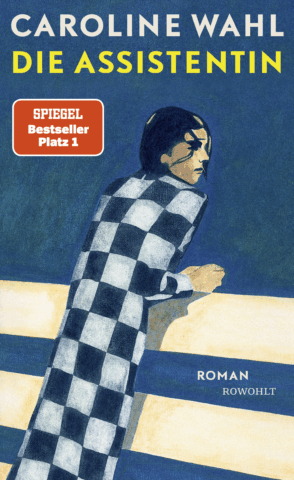
Charlotte Scharf ist 1996 geboren, Einzelkind, obere Mittelschicht, aus dem Speckgürtel um Köln, abgeschlossenes Master-Studium. Sie bewirbt sich als Assistentin des Verlegers eines renommierten Münchner Verlags. Es soll wohl eine Art Emanzipation vom Elternhaus sein, vor allem von der Mutter, mit der sie eine Hassliebe verbindet. Aber wahrscheinlich, so wird der Leser von Caroline Wahls Roman Die Assistentin zu Beginn von der allwissenden Erzählerin belehrt, war es halt nur ihr Vaterkomplex, der sie zur Bewerbung veranlasste. In jedem Fall aber eine »riesengroße Fehlentscheidung«. Oder doch nicht?
Der designierte Chef heißt Ugo Maisel, ein Münchner Lebemann, ehemaliger Tennisspieler (Platz 348 auf der ATP-Weltrangliste und 1 x Agassi geschlagen), Buchautor (mässiger bis gar kein Erfolg) und jetzt führt er diesen Verlag. Er hat eine Narbe im Gesicht (einen Schmiss?), sieht sehr kränklich aus und es beginnt der Haarausfall. Charlotte erhielt eine Zusage, allerdings für einen etwas anderen, zweitrangigeren Assistentinnenjob, aber das war ihr egal. Sie zog nach Ismaning in ein Stephen-King-ähnliches Haus, in dem unter anderem im Jahr ihrer Geburt eine Leiche gefunden worden war, aber immerhin war die Wohnung am Wasser und das war ihr wichtig.
Was nun folgt ist eine mehr oder weniger chronologische Schilderung von Charlottes Assistentinnentortur von September bis Februar, mit vielen Höhen und Tiefs und vor allem etlichen metafiktionalen Einschüben, die rasch erkennen lassen, dass hier eine Autorin auch das zielgerichtete Schreiben ihres Romans hin zu einem Bestseller thematisiert. So überlegt sie auf Seite 110, wie sie den Text von einer Erzählung oder Novelle (nicht so ganz marktkonform) in einen Roman überführen kann. Und schreibt noch 250 weitere Seiten (statt vielleicht nur weitere 100). Passend dazu dichtet sie Charlotte eine Liebesaffäre an (er heißt Bo), damit es weitergeht. Oder sie fällt sich ins Wort, wenn es zu viel oder zu wenig anekdotisch zu werden droht. Als wäre das nicht genug, baut sie auch noch innerhalb der nummerierten Kapitel kleinere Cliffhanger ein, die je nach Lage bald große oder mindestens mittlere Katastrophen andeuten oder erläutern, dass eigentlich erwartbare Katastrophen vorerst ausbleiben.
Erik-Ernst Schwabach: Bilderbuch einer Nacht
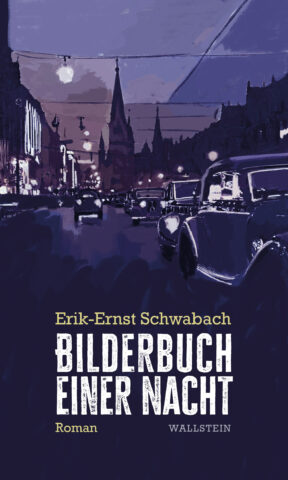
Bilderbuch einer Nacht
Nein, unveröffentlicht im strengen Sinne war der Roman Bilderbuch einer Nacht des deutschen Autors Erik-Ernst Schwabach bisher nicht. Er erschien 1938 in einem kleinen polnischen Verlag – auf polnisch! Schwabach notierte im Londoner Exil in sein Tagebuch: »Sehr komisch, ein Buch von sich in den Händen zu haben...von dem man kein Wort versteht.« Zwei Tage später erlag Schwabach mit 47 Jahren einem Herzinfarkt. Das Manuskript ging mehr als acht Jahrzehnte verschlungene Wege (in den 1950ern wurde es von Rowohlt abgelehnt). Jetzt, 2025, veröffentlicht der Wallstein-Verlag erstmalig in deutscher Sprache Schwabachs Roman. Kundig ergänzt mit einem Nachwort des Literaturwissenschaftlers und Schwabach-Biografen Peter Widlok.
Vielleicht sollte man Widloks Nachwort zuerst lesen. Schwabach wurde in eine wohlhabende jüdische Bankiersfamilie hineingeboren. Er sah sich früh als Künstler, Schriftsteller, verfasste 1913 eine Abhandlung über den Expressionismus, arbeitete bei der Literarischen Welt, gab Zeitschriften heraus, experimentierte mit dem Radio (»Funkspiele«) und betätigte sich als Kunst- und Kulturmäzen. Seine Lesungen und Feste auf dem schlesischen Schloss Märzdorf sollen legendär gewesen sein. Dann der Absturz. Schwabach hatte in Reichsmark investiert, weniger in Immobilien oder Dollar. Die Weltwirtschaftskrise traf ihn hart, er musste seine berühmte Büchersammlung und schließlich auch Märzdorf verkaufen. Schwabach floh 1933 mit seiner Familie nach Großbritannien, hielt sich mit Unterhaltungsstücken und Exposés für Theater und Filmstoffe über Wasser. In Deutschland konnte er nur noch unter Pseudonym veröffentlichen. 1936 begann er mit Bilderbuch einer Nacht.
Schwabachs Episodenbuch beginnt an einem Samstag um 18 Uhr und endet rund zwölf Stunden später. Schauplatz dürfte Berlin sein, obwohl der Name nicht fällt und bekannte Straßen oder Bauwerke nicht genannt werden. Interessant die Datierung, die er vornimmt: »20. Oktober 193.«. Der einzige 20. Oktober, der in den 1930er Jahren ein Freitag ist, findet sich im Jahr 1934. Aber im gesamten Buch gibt es keinen Hinweis auf die Nazi-Regentschaft. Es ist formal ein unpolitisches Buch.
Wer kann, sollte sich ein Personenverzeichnis anlegen, denn viele Protagonisten tauchen in dieser Nacht an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf und es ist nachträglich hübsch, wie Schwabach die Aufeinandertreffen gestaltet hat. Da ist etwa der Arzt Dr. Peter Paulsen, der auf ein Dinner bei Bankier Waldherz eingeladen ist, einer großbürgerlichen, reichen Familie. Mit eingeladen ist Ilse, Paulsens Frau, eine ehemalige Kaufhausangestellte, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt und von den Honoratioren und Prominenten von oben herab betrachtet wird. Paulsen begegnet beim Dinner Beate Meisner, eine weltgewandte und gebildete Frau, die, wie es einmal heißt, viel verspricht und er scheint ihr zu verfallen, während der Dichter Sven Marken sich für Ilse interessiert. Über all diese Personen hatte der Leser schon vorher einiges erfahren. Spät in der Nacht wird Paulsen in das Krankenhaus gerufen, weil Rudi, der Polizist und Verlobte einer Küchenhilfe der Waldherzens, bei einer Schießerei verletzt wurde.
Ein heiterer Kulturpessimist
Porträt des musischen Informatikers Peter Reichl
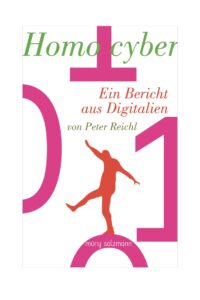
Homo cyber, der kybernetische Mensch. Nicht zu verwechseln mit dem Cyborg, der maschinelle Prothesen in seinen Körper integriert hat. Freilich tendiert auch der kybernetische Mensch dazu, sich digitale Geräte einzuverleiben. Beobachtet man Passagiere in der U‑Bahn, gewinnt man den Eindruck, dass sie ihr intelligentes »Telefon« gar nicht mehr loslassen, als könnten sie ohne es nicht existieren.
Homo viator, homo ludens… Es gab in der Vergangenheit noch andere feste Wortverbindungen mit »homo«. Homo faber – der Macher, Handwerker, Techniker – tritt im gleichnamigen Roman von Max Frisch als Inbegriff des Ingenieurs auf. Peter Reichl, der die neue Wortverbindung geprägt hat und als Buchtitel verwendet, kommt in den beiden bisher erschienen Bänden1 mehrfach auf Max Frisch und seinen Ingenieur zu sprechen. Anscheinend haben der Kybernetiker, der Informatiker, der Programmierer, aber auch der gemeine »User« von Personalcomputer und Smartphone, den Ingenieur als Leitfigur der Moderne abgelöst. Der Homo sapiens hat sich zum Homo cyber gewandelt.
In der biographischen Notiz am Ende von Reichls Buch erfahren wir zu unserer Überraschung, dass der Autor Informatikprofessor an der Universität Wien ist. Gut, der Mann hat vielerlei mitzuteilen, und manches davon geht nicht so leicht in einen mathematisch ungebildeten Kopf, obwohl da von sehr alten, verhältnismäßig einfachen Problemstellungen die Rede war. Gleichzeitig aber waren in dem Buch Haltungen ausgedrückt, Schlussfolgerungen formuliert und Vorschläge gemacht, zu denen ich selbst auf anderen Wegen gelangt war, etwa in dem Buch Parasiten des 21. Jahrhunderts. Als digitaler Skeptiker – wie der Informatikprofessor selbst? – beschloss ich, mehr darüber herauszufinden, wollte aber alles Googeln vermeiden.
Reichls Büro befindet sich in einem zweistöckigen containerartigen Annex der Wiener Fakultät für Informatik. Das Gebäude muss demnächst wieder abgerissen werden, an seiner Stelle wird dann, wer weiß für wie lange, wieder eine Baulücke sein. Was an Reichls körperlichen Erscheinung zunächst auffällt, ist der graue, fast weiße Rauschebart, dazu kleine, springlebendige Augen hinter der eckigen Brille. Eine gewisse Fülligkeit ist nicht zu verleugnen – man könnte den Mann mit der kräftigen Stimme für einen Opernsänger halten, und tatsächlich wäre er in jungen Jahren fast ein solcher geworden. Auf den Arbeitstischen stehen kleine, altertümliche Rechenmaschinen, wie ich sie von Ablichtungen in den beiden Büchern kenne. Reichl liebt es, auf die Frühgeschichte der Informatik hinzuweisen, deren Beginn man etwa 1623 ansetzen kann. In diesem Jahr erfand der deutsche Gelehrte Wilhelm Schickard eine Rechenmaschine, mit der man vielstellige Zahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren konnte.
Arnold Maxwill: Lieber nicht
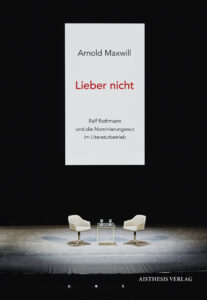
Da hört der Literaturwissenschaftler Arnold Maxwill 2023 ein Interview mit dem Schriftsteller Ralf Rothmann auf WDR5 und ärgert sich, dass nach noch nicht einmal zwei Minuten die Rede auf Rothmanns Absage, sein Buch zum Deutschen Buchpreis 2015 einzureichen, thematisiert wird. Die Causa scheint, so Maxwill, »wichtig genug, um sie gleich an den Anfang zu stellen«. Nun, sie ist offenbar derart wichtig, dass man darüber nach inzwischen zehn Jahren ein Buch über 77 Seiten plus 265 Anmerkungen auf weiteren 43 Seiten schreibt.
Durch seinen Verlag Suhrkamp hatte Rothmann 2015 ausrichten lassen, seinen Roman Im Frühling sterben nicht zum Deutschen Buchpreis einzureichen. »Ich möchte nicht«, so lautet die Formulierung, die er hierfür verwendet haben soll. Eine Paraphrase der Melville-Figur Bartleby, der in seiner Position als Angestellter mit »I would prefer not to« passiven Widerstand seinem Chef und überhaupt der Welt gegenüber leistete. Maxwill nennt denn sein Buch passend Lieber nicht.
Schon 2008 hatte Peter Handke den Börsenverein gebeten, seine Erzählung Die morawische Nacht, die auf der Longlist gelandet war, zu entfernen, um jüngeren Autoren den Vorrang zu geben. Ab und an kommt Maxwill auf Parallelen zwischen Handke und Rothmann zurück. Sein Fokus liegt jedoch eindeutig auf Ralf Rothmanns Textgenese, seinem Umgang mit Manuskripten und dem (leider notwenigen) Literaturbetrieb im speziellen und allgemeinen.
Zoom auf den Epochenverschlepper
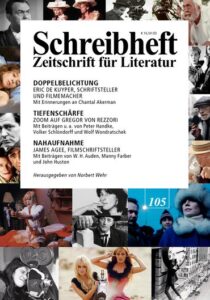
Neues und Altes über und von Gregor von Rezzori
Anlasslos findet sich im neuen Schreibheft von Norbert Wehr unter anderem ein Dossier über den 1998 verstorbenen Gregor von Rezzori, kuratiert von José Aníbal Campos und Jan Wilm. Geboren wurde von Rezzori 1914 in Czernowitz, damals Teil der Habsburger Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel die Bukowina vorübergehend an Rumänien, später wurde sie von Stalin einverleibt. Von Rezzori, der fünf Sprachen fließend beherrschte, pendelte zwischen Österreich und Rumänien, strandete schließlich Ende der 1930er Jahre als de facto Staatenloser in Berlin und begann zu schreiben. Zum Ende des Krieges verließ er Berlin nach Schlesien. Von da aus floh er vor den Russen und wurde mit etwas Glück Mitarbeiter des NWDR. In den 1950er Jahren erfand er sein fiktives »Maghrebinien«, ein Phantasieland mit starken Bezügen auf seine ehemalige Heimat und, wie es im Schreibheft heißt, »mitunter pikaresken ironischen Elegien auf ein versunkenes Mitteleuropa«. (Einige Einblicke in dieses Maghrebinien liefert ein Vortrag aus 2017 von Jurij Andruchowytsch ). Wie so oft wurde Erfolg auch Bürde. Seine spätere Prosa nahm man insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht besonders ernst. Von Rezzori wurden Images verpasst, Märchenonkel und Lebemann etwa, später dann »Grandseigneur«. Meinte man es gut, nannte man ihn »Epochenverschlepper«, eine Bezeichnung, die er für sich selbst gefunden haben will. Damit sei »das anachronistische Überlappen von Wirklichkeitselementen, die spezifisch einer vergangenen Epoche angehören, in die darauffolgende« gemeint, so seine Definition.
Eine Titelgeschichte im Spiegel in den 1960er Jahren fiel wenig schmeichelhaft für ihn aus und sollte das Bild über ihn viele Jahre bestimmen. Jeder kannte ihn und er kannte jeden; eine Art »Zelig« des Kulturbetriebs. Seit Mitte der 1960er Jahre wohnte er mit seiner dritten Frau in einem von ihm sukzessive renovierten Anwesen in der Toskana. Neben Illustrierten-Artikeln (er selbst nannte es »journalistische Prostitution«), Feuilletons und Romanen schrieb er auch Film-Drehbücher und trat als Gelegenheitsschauspieler auf, obwohl er kein Cineast war. In Viva Maria von Louis Malle etwa als Zauberer. Über die Dreharbeiten in einer fünfmonatigen Zeitkapsel, den Regisseur Louis Malle, die beiden Hauptdarstellerinnen Jeanne Moreau und Brigitte Bardot, die Art und Weise, wie ein Film entsteht und seine Rolle im Intrigenstadel hat er ein launiges Tagebuch geführt, dass zunächst ausschnittweise in drei verschiedenen Medien erschien und dann gesammelt unter dem Titel Die Toten auf ihre Plätze. Literarisch wird es immer dann, wenn er von der Weite Mexikos erzählt, jenes Landes, das er schon zu Beginn zum Balkan Amerikas erklärte.
Cyborgs und Humanoide 2
Ich möchte der ersten, heillos unvollständigen Liste der Automatisierungen eine ganz andere gegenüberstellen, die Liste der menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, soweit sie nicht von Maschinen übernommen werden können, die also die Menschen im Vergleich zur Maschine auszeichnen. Früher haben Philosophen gern Mensch und Tier verglichen, um zu Aussagen über die Spezifik des ersteren zu gelangen. Im 21. Jahrhundert scheint es ergiebiger, den Menschen mit der intelligenten Maschine zu vergleichen. Und nicht nur ergiebiger – für mich als alten Humanisten – old school, was will ich machen – geht es vor allem darum, welche Eigenschaften und Fähigkeiten, etwa durch die Bequemlichkeitswirkung des Internets und vor allem des Smartphones, bedroht sein könnten und bewahrt werden sollten. Eine Zeitlang, es ist schon einige Jahre her, hatte ich in Kants Kritiken gelesen, weil ich dachte, dort wären unsere humanen Eigenschaften aufgelistet, aber das hat mich nicht viel weiter gebracht – vielleicht hat mir das dauernde kantische Ableiten- und Begründenmüssen von Sätzen den Überblick getrübt. Andererseits glaubt ohnehin jeder Mensch, wenigstens ungefähr zu wissen, was ihn als Menschen denn ausmacht. Ein kürzlich erschienenes Buch, Menschlichkeit von Jürgen Goldstein, verspricht, die Besonderheiten zusammenzufassen, aber es sagte mir nicht viel Neues: Renaissance, Erasmus, Montaigne (den ich halb auswendig kann), Aufklärung, das alles hatte ich im selben Schema schon vor fünfzig Jahren gelernt und einigermaßen behalten. Auch daß Biologismus und Rassismus und vor allem, wie Hitler und die Seinen diese »Disziplinen« in die Tat umsetzten, das Gegenteil von Humanismus bedeutet. Interessant in Goldsteins Buch sind allerdings die späten Kapitel über neuere Bestrebungen, das Humane zu »überwinden«. Technikchauvinismus und Anti- oder Posthumanismus greifen da ineinander. Aber sonst? Was ist eigentlich das Humane, und wie kann, wie soll es fortbestehen? Läßt es sich auflisten? Muß es notgedrungen hybrid, technoid werden?
Eine Ordnung werde ich wohl nie in meine Ahnungen bringen können, dazu bedarf es eines systematischeren Geistes. Es wird bis auf weiteres bei einem Brainstorming bleiben, das sich vielleicht sukzessive ausweiten läßt. Fenster auf, Sturm im Kopf, die Blätter rascheln. Mehr als ein solches Blätterrascheln bringe ich nicht zustande. Keine Hierarchien. Man könnte das Angewehte wenigstens alphabetisch ordnen. Aber wozu?
Wir sind die Unberechenbaren. Diese Aussage sollte schon mal nicht am Anfang stehen sondern am Ende, eine Art Resümee. Unsere »Applikationen« – was auf deutsch nichts anderes heißt als: unsere Anwendungen (von Technologie) – lesen uns, berechnen uns, rechnen uns aus, sagen uns vorher. Die Technologiekonzerne stellen uns, natürlich nicht ohne Profitinteresse, Kopiloten, Gesprächspartner, Diener, Freunde, Seelsorger zur Seite, das alles in einer Person, Einsamkeit ist aus der Welt geschafft, jedermann und jedefrau geht in steter Begleitung durchs Leben, wie man in jedem beliebigen öffentlichen Raum beobachten kann.
Frédéric Schwilden: Gute Menschen
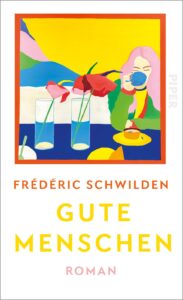
Gute Menschen
Frédéric Schwilden ist Reporter und Kolumnist bei der Welt. Auf X postet er unter @totalreporter. Manchmal sieht man ihn dort, wenn er unterwegs ist, im Zug, in atemberaubend bunten Sakkos. Vor einigen Wochen erschien eine großartige Intervention zu Depressionen und dem Brief von Wolfgang Grupp nach dessen Suizid-Versuch. Davor las ich seine Besuchsberichte bei Rainer Langhans und Uwe Tellkamp. Schwilden ist neugierig und überlässt dem Leser das Urteilen; ein Reporter im altmodischen Sinn. Jetzt legt er mit Gute Menschen seinen zweiten Roman vor.
Er handelt von Jan und Jennifer. Beide sind 1988 geboren, verheiratet und leben in München. Sie ist Partnerin einer Kartellrechtskanzlei (daher der Ehevertrag), er Gymnasiallehrer. Gute Menschen beginnt mit dem Auszug von Jennifer aus der gemeinsamen Wohnung. Es ist der 18. Dezember 2023. Jan ist bei der Großmutter in Krefeld. Jennifers Habe füllt ein V‑Klasse-Taxi zur Hälfte. Sie hat ihre Kanzleianteile verkauft, hinzu kommt ein Erbe. 1,5 Millionen Euro hat sie auf dem Konto. Sie lässt sich zu ihrer neuen 144 m² großen Wohnung fahren. Der La Chaise von Eames wird geliefert; mehr als 8.000 Euro. Die anderen Möbel kommen in den nächsten Tagen. Sie hat Jan einen Brief geschrieben und in den Briefkasten geworfen. Sie beendet die Ehe. Man stritt über Geld. Geld, das man hatte. Man stritt darüber, wie man es ausgibt. »Ich will raus« schreibt sie. Will seine Freundin bleiben. Die eheliche Wohnung überlässt sie ihm.
