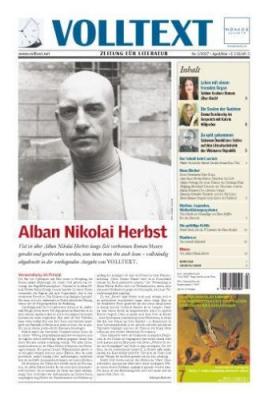Im Gegensatz zu den klassischen Menschheitskatastrophen der Vergangenheit (Naturkatastrophen; Seuchen) stehen heute als Resultate bewusster Entscheidungen die Risiken, die von industriellen Grosstechniken ausgehen. Sie brechen nicht schicksalhaft über uns herein, sie sind vielmehr von uns selbst geschaffen…hervorgegangen aus der Verbindung von technischem Nutzen und ökonomischen Nutzenkalkül. Diese Risiken, die nicht an den Grenzen von menschlich geschaffenen, also künstlichen Nationalstaaten Halt machen, sondern globale Auswirkungen haben können, untersucht Ulrich Beck in seinem Buch über die Weltrisikogesellschaft.
Beck lässt keinen Zweifel: Die moderne Gesellschaft krankt nicht an ihren Niederlagen, sondern an ihren Siegen. Die Probleme der von ihm sukzessive entwickelten Weltrisikogesellschaft sind demzufolge nicht Produkte fehlerhaften Handelns, sondern immanent im Handeln in modernen Gesellschaften angelegt. Die Lösung der Probleme der Welt hat wieder neue Probleme geschaffen. Diese Probleme nennt er Risiko:
-
Risiko ist nicht gleichbedeutend mit Katastrophe. Risiko bedeutet die Antizipation der Katastrophe. Risiken handeln von der Möglichkeit künftiger Ereignisse und Entwicklungen, sie vergegenwärtigen einen Weltzustand, den es (noch) nicht gibt. Während die Katastrophe räumlich, zeitlich und sozial bestimmt ist, kennt die Antizipation der Katastrophe keine raum-zeitliche oder soziale Konkretion. […] In dem Augenblick, in dem Risiken Realität werden – wenn ein Atomkraftwerk explodiert, ein terroristischer Angriff stattfindet – verwandeln sie sich in Katastrophen. Risiken sind immer zukünftige Ereignisse, die uns möglicherweise bevorstehen, uns bedrohen. Aber da diese ständige Bedrohung unsere Erwartungen bestimmt, unsere Köpfe besetzt und unser Handeln leitet, wird sie zu einer politischen Kraft, die die Welt verändert.