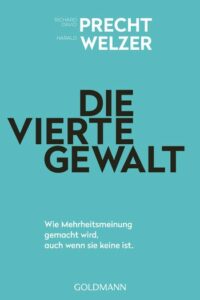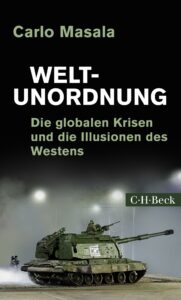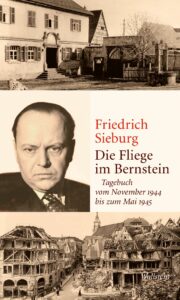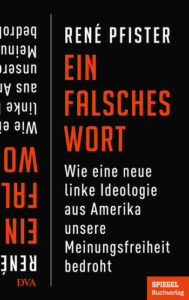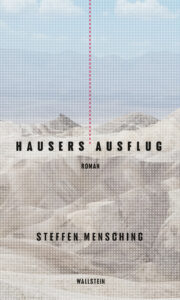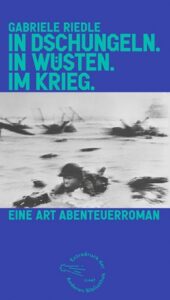
In Wüsten. Im Krieg.
In Nicolas Borns Roman »Die Fälschung« von 1979 sitzt der Reporter Laschen, der vom libanesischen Bürgerkrieg berichtet, täglich zusammen mit anderen Journalisten in einem Hotel und sortiert die jeweiligen Pressemitteilungen der Kriegsparteien. Der Publikationsdruck zwingt ihn Propagandamaterial zu lesen, Fotos zu machen, Interviews zu führen, unzuverlässige Augenzeugen zu befragen. Für Ortstermine außerhalb des Schutzraums Hotel sind die Journalisten auf zuverlässige Übersetzer und vor allem das Goodwill der jeweiligen Warlords und deren Schutz angewiesen. Dabei weiß Laschen, dass er immer droht, von einer Seite vereinnahmt zu werden und doch versucht er, so etwas wie die Wirklichkeit einzufangen.
Joris Luyendijk, Arabist und Korrespondent des niederländischen Fernsehens von 1998 bis 2003, beschrieb 2007 in seinem Buch »Wie im echten Leben« desillusioniert die Unmöglichkeit einer auch nur halbwegs objektiven Berichterstattung. Der Reporter würde zerrieben zwischen der Propaganda der unterschiedlichen Parteien. Von seinen Auftraggebern blieb immer weniger Raum für die ausführliche Darstellung von Konfliktlinien; es galt, die schnelle, knallige Schlagzeile zu liefern. Komplexe Sachverhalte werden eingedampft. Die Entscheidung, was gesendet, was wie gedruckt wird, treffen andere.
Weitere Kriege und ein paar Digitalmedien weiter lassen Kriegs- und Krisenberichterstatter als die letzten Abenteurer der Welt neu auffrischen. Derweil sich die einstigen Printreporter immer mehr darauf verlegen, ihre Erlebnisse in einen fiktionalen Text zu transformieren. Sie changieren häufig zwischen Vermächtnis, Heldengeschichte, Melancholie oder Resignation über die Schlechtheit der Welt und die Unbelehrbarkeit der Menschen. Manchmal schwingt noch das Bedürfnis mit, einen Schlüsselroman zu schreiben, um die Neugier des Rezipienten auf Medieninterna zu lenken, sofern die entsprechenden Protagonisten bekannt genug sind.