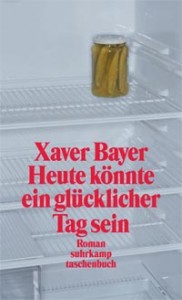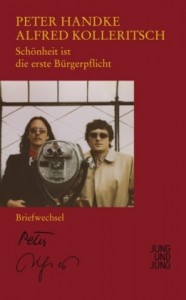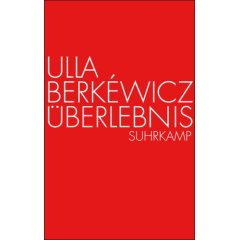
Die einzige Angst, die ich jetzt noch habe, ist die, zu vergessen. So beginnt dieses Buch. Jenseits des Vergessens ist die Zeitlosigkeit. Und jenseits der Zeit die Ewigkeit. Aber schon im Erinnern, dem Versuch, nicht zu vergessen, steckt die Gefahr der Verschollenheit: Ist die Erinnerung entrückt, in den Gedächtniskammern eingeschlossen? Die Erinnerung an den unwirklichsten Sommer zweitausendzwei. Und der »Preis« für die Erinnerung: Geht der [Sommer] immer und nie vorbei?
Trostlosigkeit – Vergessen ist ein matter, haltloser Landstrich, der zu nichts führt – und Hoffnung, dass hinter jenem Landstrich noch ein zweiter läuft, wie alles noch ein Zweites hat, vielleicht sogar sein Drittes, Viertes. Ein andrer Landstrich in einem andren Land, wo das Vergessen sich sammelt, konzentriert, besinnt.
Ulla Berkéwicz umkreist das Vergessen in diesem Buch – und natürlich nicht nur das. Es geht ums Sterben und den Tod (und damit um das Leben) und es geht – dezent und diskret – um Liebe. Aber es ist mehr als ein Lebens‑, Liebes‑, Todes- oder Totenbuch, mehr als somnambule (und dann doch gelegentlich affektierte) Litanei einer Witwe, mehr als metaphysische (Selbst-)Tröstung, mehr als eine Kritik an den Verhältnissen unserer Krankenhäuser, mehr als expressionistisch-assoziative Klagerede (mit Spucke auf einem Stein statt lutherischem Tinten- oder cantervillschem Blutfleck). Ja, es ist alles das. Und eben mehr. Viel mehr.