Die (Feuilleton?)Journalistin Johanna erhält zwischen Mai und August 2020 insgesamt sechs Postkarten von ihrem Freund Max, einem (und ihrem) ehemaligen Universitätsdozenten. Es beginnt mit »Wie geht es Dir?« und einer Ansicht der griechischen Insel Patmos, auf der Max seit Jahren lebt. Die Korrespondenz zwischen den beiden, die nur brieflich möglich ist, da Max keinen Internetanschluss hat, muss wohl ins Stocken geraten sein. Inzwischen ist mindestens die halbe Welt in einer Pandemie. Die Frage nach dem Befinden scheint also berechtigt. Im weiteren Verlauf schickt der »alte Freund« der »lieben Freundin« noch fünf Gemälde-Ansichtskarten mit orakelhaften, handschriftlichen Sprüchen, die im Buch abgedruckt sind. Johanna schickt auf die unregelmäßig eintreffenden Karten insgesamt 16 Briefe (plus einer Karte am Ende) an Max. Streng genommen handelt es sich also um einen Briefroman. Der Briefcharakter wird durch die handschriftlichen Gruß- und Abschiedsformulierungen noch verstärkt; die Briefe selber sind am Computer geschrieben.
Johanna ist nicht nur trauernd und verzweifelt, weil ihre 84jährige Mutter nach einer fahrlässigen Italienreise auf der Intensivstation an der neuen Krankheit verstorben ist, sondern auch wütend über die Umstände dieses Sterbens. Einerseits beklagt sie den Leichtsinn der Mutter, die die Krankheit wohl bagatellisiert hatte und es genoss, in den Uffizien ohne andere Touristen zu sein während in den Nachrichten bereits Schreckensmeldungen liefen. Dann wiederum wirft sie den politisch Verantwortlichen Übervorsichtigkeiten vor. Denn sie wurde nicht mehr zu ihrer Mutter ins Krankenhaus gelassen. »Den Sicherheitsdienst haben sie gerufen, als ich versucht habe, trotzdem in das Gebäude reinzukommen. Irgendwo da drinnen hing meine Mutter an irgendwelchen beschissenen Maschinen, war am Ersticken, Verrecken, und sie haben mich nicht zu ihr gelassen!!!!«
Diese Wut setzt sich bei der Beerdigung fort. Die Mutter war prominent, betrieb eine Schauspieler-Agentur, stand früher selber auf der Bühne. Sie hatte einen Plan entworfen, wie ihre Beerdigung auszusehen hatte – das übliche Fest, auf dem alle fröhlich zu sein haben. Und dann dies: »Wie versprengte schwarze Schäfchen standen Mutters Schauspieler, Mutters Freunde, Mutters ‘Geschöpfe’ auf den beiden Straßen um den Friedhof herum. Ausgesperrt von den Mauern. Bewacht von mindestens zwanzig Ordnungshütern…« Tatsächlich mutet einiges recht skurril an: »Aus Gründen, die einzig die Hygienegötter kennen, durfte keiner Erde ins Grab werfen. Nur Blumen.«
Johannas Wut setzt sich fort mit ellenlangen Passagen über das Verdrängen des Todes. Sie sagt ihm mit Canetti als Gewährsmann wissend zwischenzeitlich den Kampf an und polemisiert unter anderem gegen Sokrates und Seneca (letzterer scheinbar Max’ Lieblingsphilosoph). Irgendwann erkennt sie, dass es weniger der Tod ist, vor dem die Gesellschaft sich fürchtet (und flüchtet), als das Sterben. »Wir müssen wieder sterben lernen«, deklamiert sie: »Wenn der Fortschritt der medizinisch-technologischen Künste dazu führt, dass die Kunst des Sterbens verschwindet, dient er nicht dem Leben, sondern der Unfreiheit.« Das Sterben wird so – auch nicht neu – zu einem Freiheitsrecht. Und dann noch, wie Sokrates auf dem Bild von Jacques-Louis David, in Gesellschaft! Das wär’s. Ja, möchte man Johanna zurufen, wenn das so einfach wäre… Und wie hätte sie reagiert, wenn die Ärzte die Mutter nicht an die »beschissenen Maschinen« angeschlossen hätten?
Hart geht Johanna mit den Maßnahmen der Politik für die Pandemie ins Gericht. Ja nach Stimmung sind sie ihr zu hart, dann wiederum nicht zwingend genug. Andere Vorschläge macht sie selber nicht. Stattdessen wird das große Geschütz aufgefahren: »Was wir brauchen, ist ein Aufstand. […] Ein Aufstand gegen die Technokratie.« Eigentlich will sie öffentlich ihr Wort erheben, aber dann überwiegt doch der »vorauseilende Angstgehorsam jener freudlos-zähen Massendisziplin«, die sie gleichzeitig schrecklich findet. Verzweifelt stellt sie fest, dass fast ausschließlich Querdenker, Neonazis und »Spinnervolk« gegen die Maßnahmen protestieren. Mit ihren Briefen an Max versucht sie einen philosophisch grundierten, politisch stimmigen Protestweg zu finden.
Dabei kokettiert sie durchaus mit ihrer Intellektualität, die ihr bisweilen im Weg stehe. Zwar werden fortlaufend alle möglichen Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart zitiert bzw. paraphrasiert. Zu häufig habe man statt zu lesen »auf den toten Buchstaben« herumgekaut. Auch das gelingt dann weniger und schließlich bricht es gewollt vulgär heraus: »Ich will von dem altklugen Scheiß, den ich fabriziert habe, als ich noch vollkommen ahnungslos gewesen bin, was Verzweiflung ist, nichts mehr wissen!« Max herrscht sie an: »Hör auf mit diesem Um-die-Ecke-Geraune! Mit diesem Bilderrätsel-Scheiß!« Schluss soll gemacht werden mit dem »verhirnten Quark«, der seit ihrem Studium ihr Leben Denken bis hinein in den Alltag bestimmt. Aber geht das?
Die Lösung kommt dann überraschend schnell. Sie kündigt ihre Stellung bei der Zeitung – halb genüsslich, halb verzweifelt die Szenerien aus der Vergangenheit, die eigentlich schon lange eine Kündigung hätte zwingend nach sich ziehen müssen – und sloterdijkt (nicht zum ersten Mal): »Ich muss mein Leben ändern«. Johanna verlässt Berlin, kontaktiert ein paar Freunde und fährt nach Capri, sucht den »Trost durch Gesellschaft«, beginnt, wie es scheint, wieder zu leben. Die letzte Nachricht ist eine Postkarte an Max mit den Unterschriften der Reisegesellschaft. Wie früher bei einer Klassenfahrt.
Das Buch, herausgekommen im Februar 2021, konnte aktuelle Entwicklungen nicht berücksichtigen; es konzentriert sich weitgehend auf die Lage im Frühjahr und Sommer 2020. Ob die Autorin beim Schreiben klüger war als ihre Hauptfigur, bleibt dahingestellt. Thea Dorn hat wiederholt die biopolitischen Corona-Maßnahmen der Regierung, die nahezu ausschließlich virologische Aspekte berücksichtigt, kritisiert. Das kann, das muss man aushalten. Aber diese Position hat(te) durchaus Auswirkungen auf die Rezeption von »Trost«. Bei einigen Protagonisten löste die Lektüre Unbehagen jenseits literarischer Kriterien aus. Fast scheint es eine Blasphemie zu sein, beispielsweise auf die psychischen Auswirkungen von monatelangem Dauerlockdown und Kontaktsperren auch nur hinzuweisen.
Die Autorin macht es der Kritik allerdings ziemlich leicht. Denn die hyperventilierende Mischung aus Selbstmitleid und Wut, die sich unter anderem in zeitweiliger Großschreibung und inflationären Ausrufezeichen zeigt und die man eher in einem Internetchat vermuten würde und gleichzeitig die halbgaren Versuche, existentialphilosophische Erkenntnisse über den Tod in der Gegenwart zu formulieren (nichts davon ist neu, manches satirisch überspitzt), ermüden den Leser rasch. Johannas Erkenntnisgewinne sind bei näherer Sicht fast immer nur Trivialitäten.
Gerne liest man die Episoden über ihre Mutter, würde mehr von ihr erfahren wollen. Aber diese Erinnerungen sind nur Startblöcke für das peinliche Suhlen der Tochter in immer neuem Jammern und süßsaurem Weltschmerz. Sicherlich, es gibt einige wohlgesetzte, durchaus bernhardeske Schimpftiraden (über den politischen Opportunismus der Zeitungsredaktion, den Haltungsjournalismus und dem Ökojakobinertum) und manch treffendes Bonmot (wie etwa »den neu geschaffenen Begriff der ‘Soloselbstständigen’ mit ‘Allein-im-Regen-stehen-Gelassenen’ « zu übersetzen), dass den Leser kurzfristig einnimmt. Aber überzeugend ist dies nicht.
Statt eines Aufstands der »Schönheitstrunkenen« und »Würdesüchtigen« gibt es schließlich eine Reise nach Capri, also so etwas wie zivilen Ungehorsam, was das Reisen in Pandemiezeiten angeht. Vielleicht gibt es darüber – gerne mit etwas mehr Abstand – den nächsten Roman. Denn »Trost« lässt den Leser ungetröstet und auch etwas ärgerlich zurück.
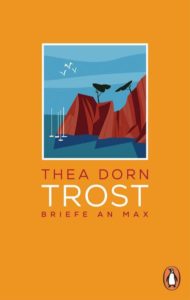
Thea Dorn hat den Nachteil, dass sie eine Live-Öffentliche Person ist. Man kennt sie vom Podium und den Diskussionen. Damit kennt man auch ihre »maximale Tiefe«, und ihr Talent, sich selbst ins Abseits zu quatschen.
Ich mag sie, keine Frage! Aber ich fürchte, ich kann das nicht lesen, ohne T.D. vor meinem inneren Auge reden und argumentieren zu hören. Vielleicht liest sich das besser, wenn man die Autorin nicht kennt?!
– Thema: Ich schmeiße hin! Offenbar ein neuer Trend. Gunnar Kaiser hat öffentlichkeitswirksam hingeschmissen, Thea Dorn übt schon auf der fiktionalen Bühne. Die Reisegruppe ist dann wohl eher Satire.
Das Unbehagen über die Diskrepanz zwischen Bildungscharakter (die formstabile Persönlichkeit nach einem Übermaß Altphilologie) und zeitgenössischem Passagier würde ich ernst nehmen. Das geht offenbar vielen so. Erfahrung: »Ich bin nicht nur wahnsinnig gebildet, sondern auch wahnsinnig überflüssig, bestenfalls noch ein politischer Querulant...«. Unangenehm.
Interessant, dieser Gedanke an Satire. Merkwürdigerweise bin ich darauf gar nicht gekommen.
T. D. war ja ursprünglich Kriminalautorin und hat dann irgendwie den Sprung ins Feuilleton geschafft. Es gab einmal auf ihrer Webseite ein Bild von ihr. Sie steht dort wie eine Pathologin mit blutgeschmiertem Kittel. In den Händen hält sie ein Tablett mit einem scheinbar frisch entfernten Gehirn. (Es ist längst nicht mehr im Netz abrufbar; ich habe es noch auf meinem Rechner, befürchte jedoch, dass es rechtlichen Ärger gibt, wenn ich es publizieren sollte.)
Dorn hat ja das »Literarische Quartett« sozusagen übergeben bekommen und müht sich dort mit immer drei neuen Gästen um Literaturkritik im Fernsehen. Bisweilen gelingt es, oft genug eher nicht. Es ist immer problematisch, wenn Schriftsteller auch noch regelmässig als Literaturkritiker tätig sind. Ich kenne keinen Sternekoch, der auch als Restaurantkritiker fungiert. Das macht per se ihre Rolle – schwierig.
Ich dachte, mit Capri stimmt was nicht. Das ist die Insel der Komponisten, Frederic Chopin, William Walton, Hans Werner Henze, etc. Die Musik schätzt Thea Dorn sehr, also würde sie sich (persönlich) gerne unter den Schutz der Ortsgeister begeben, kann darüber aber nicht schreiben, weil es mit Sicherheit kitschig gerät. Also versteckt sie ihre Zuneigung in einer mediokren Reisegruppe, wo sich bekanntlich niemand für seine Sentimentalität schämen muss.
Zu kompliziert?!
Chopin hat die eine oder andere Caprice komponiert, lebte aber zeitweise auf Mallorca und nicht auf Capri. William Walton hingegen lebte auf Ischia. Das ist zwar deutlich näher dran, aber immer noch nicht identisch mit der »Komponisteninsel« Capri...
Henze lebte auf Ischia.
Da stimmt also wirklich was nicht mit Capri...
Danke für die Info. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr, was es mal war.
Wem sagen Sie das!