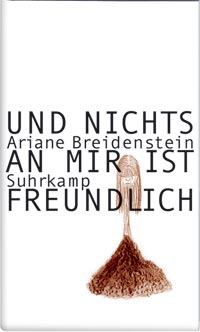Die feinfühlig-reflexiven Erzählungen des Rainer Rabowski

Die gerettete Nacht
Momente der Wonne: Eine Frau und deren Lächeln heraus einer Art Sekundenbeischlaf an Mitwisserei und Komplizenschaft, wie er manchmal unter völlig Fremden möglich ist, durch nichts weiter bedingt. Kontrastierend mit dem Wühlen eines Selbst-Entwurzelten in einem riesigen Haufen Sperrmüll, redselig auf eine schräg-umständliche Weise, ein geistiges Verstolpern im allmählichen Sortieren und Sichten des erst noch zu findenden Lageplans seiner Gedanken. Es sind fast Epiphanien, die Rainer Rabowski da beschreibt, nein – darauf muss man bestehen -: erzählt. Es sind Erzählungen, »Lebensmitschriften« vom Aufgehobensein in eine von allem anderen gelöste[n] Bewegung. Was doch diese Schlaflosigkeit, die dem Ich-Erzähler in schöner(?) Regelmäßigkeit (oder Unregelmäßigkeit?) alles hervorbringt: Ein Flanieren in der Stille der Nacht. Einer Nacht, die, wenn man genau hinhört, hinsieht und riecht diese Schönheit des…alles genau beobachtenden Tiers zu erzeugen vermag (ganz im Gegensatz zur schaurig-affektiven Jekyll/Hyde-Verwandlung).
Da der Ich-Erzähler namenlos bleibt, ist es verführerisch, ihn mit dem Autor gleichzusetzen oder zu verwechseln. Der Ort ist überdeutlich Düsseldorf (die Stadt Peter Kürtens, wie es einmal heißt) und mehr als nur Kulisse (wie sich schon in der Bezeichnung »Düs-Tropien I« auf der ersten Seite zeigt): Tausendfüßler, Gleisanschluss Gatherhof, Hauptbahnhof Hintereingang, Fürstenplatz, Burgplatz, Bilker Allee, Seestern, Ecke Herzog-/Corneliusstraße, Gustav-Poensgen-Straße, Karolingerstraße, etc. Wer will, kann auf einer Karte Punkte machen, diese verbinden und erhält ein Bewegungsprofil. Obwohl: die wirklich wichtigen Orte bleiben angedeutet, etwa die B‑Straße, G‑Straße oder K‑Straße – als gelte es, diese jungfräulich zu erhalten und dem Zugriff des neugierigen Lesers zu entziehen.