Eigentlich wollte Petra Gerster in der »heute«-Sendung vom 05.11.09 zeigen, wie »dramatisch« die Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind. Da jedoch bei Kategorien von 500 Milliarden Euro und mehr die Relationen schwer vermittelbar sind, schritt man zur hyperdeutlichen Graphik, in der die Balken nur ab 500 Milliarden gezeigt wurden:
Medien
heute ./. tagesschau
Erdbeben in Padang. Peter Kunz berichtet für das ZDF in »heute«. »95% der Großstadt sind intakt«; die Zerstörungen der Stadt seien lokal auf einzelne Häuser bzw. Viertel begrenzt. Die Bilder, so Kunz vorsichtig, würden leicht einen anderen Eindruck vermitteln (»ZDF«-Mediathek; 19 Uhr-Sendung vom 01.10.09 ab ca. 03:15).
In der »tagesschau« um 20 Uhr der Korrespondent Philipp Abresch live via Satellitentelefon: Padang liege »in Trümmern« (ab 02:16).
Desinformation bei der »tagesschau«
Die »tagesschau« ist auch nicht mehr das, was sie früher war. Soeben konnte man dies deutlich feststellen, hieß es doch in einem an prominenter Stelle platzierten Beitrag von Pia Bierschbach in der Sendung von 20 Uhr, dass das Wahlrecht kurz vor der Bundestagswahl in der Diskussion gekommen sei. Es gehe, so der Film, um die Regelung der Überhangmandate. Detailliert wurde erklärt, wie Überhangmandate zustande kommen. Dabei wurde erläutert, dass eine Partei unter bestimmten Umständen mehr Mandate bekommen kann, als ihr gemäss der abgegebenen Stimmen zustehen. Dann wird behauptet, dass das Bundesverfassungsgericht eine Regelung bis 2011 verordnet habe, dies abzustellen.
Dieser Schluss ist nachweislich falsch. Das Bundesverfassungsgericht hat keinesfalls die Regelung der Überhangmandate beanstandet, wie dies im Beitrag der »tagesschau« suggeriert wurde. Zwar ist im Beitrag versteckt an einer Stelle von »Teilen der Überhangmandatsregelung« die rede, die beanstandet wurde, aber welcher Teil das ist, bleibt undeutlich. Der Zuschauer muß annehmen, es betreffe generell die Überhangmandate.
Michael Jürgs: Seichtgebiete
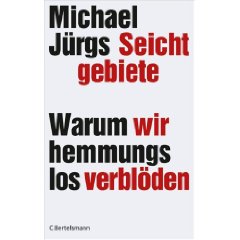
Wer hat das nicht schon einmal erlebt? Man trifft auf einer Party einen Zeitgenossen, mit dem man sofort in vielen Punkten gleicher Meinung ist. Andere kommen hinzu und nehmen in der Debatte teilweise konträre Positionen ein. Man verteidigt den Angegriffenen. Und plötzlich holt dieser zu verbalen Rundumschlägen aus, verlässt das scheinbar so fruchtlose Argumentieren, beschimpft die Mitdiskutanten rüde und wundert sich am Ende, das niemand seine Sicht der Dinge teilt, was dann zur Bestätigung der These herangezogen wird, dass alle anderen eh’ zu blöde sind. Achselzuckend geht die Runde auseinander und mit den Schimpfkanonaden des Beleidigers ist der Kern der eigenen Überzeugung auch gleich ein bisschen mitdiskreditiert worden.
Der Volksmund hat dieses Dilemma im Sprichwort vom Ton, der die Musik macht, festgehalten. Und mehr denn je gelten im Diskurs bestimmte Gebote, die ihn überhaupt erst ermöglichen. Das bedeutsamste ist die gegenseitige Akzeptanz. Ohne das gegenseitige Anerkennen ist ein Diskurs undurchführbar. Die Regeln dieses respektvollen Diskutierens, die zunächst im informellen Gebrauch geformt werden und dann allgemeine Gültigkeit durch Gebrauch erhalten, sind in den letzten Jahrzehnten immer präziser und teilweise durchaus repressiver geworden. Zudem wurden inzwischen institutionell verankerte und sanktionierte Ge- bzw. Verbote ausgesprochen. Viele sehen daher in öffentlichen Diskussionen inzwischen immer mehr übertriebene Korrektheiten, die formale Elemente dem argumentativen Austausch unterordnen. Die Folge seien, so die These, häufig blutleere Beiträge, die sich mitunter in elaborierter Wortgymnastik ergehen.
Faktor 13
Lassen wir einmal beiseite, was an den Meldungen stimmt, dass es ein geheimes Waffengeschäft zwischen Nordkorea und dem Iran gegeben hat. Interessant ist der Aufmacher auf tagesschau.de (13.30 Uhr, 29. August 2009):

Die Kartenausschnitte der jeweiligen Länder suggerieren, dass beide Staaten eine ähnliche Grösse haben. Ein Blick auf die Fakten zeigt aber etwas anderes:
Roger de Weck und Frank Schirrmacher
Anregendes und informatives Gespräch über Qualitätsjournalismus, neue Medien, das deutsche Feuilleton, freie Mitarbeiter, Reich-Ranicki und Niggemeier und das Recht des Lesers von bestimmten Trivialitäten nicht belästigt zu werden. De Weck fragt spöttisch und streng und zwingt Schirrmacher gelegentlich in die Defensive.
Astrid Herbold: Das große Rauschen
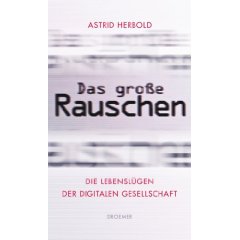
Es geht ums ganz Große: »Die Lebenslügen der digitalen Gesellschaft« will Astrid Herbold »bissig im Ton und scharf an der Analyse« (Klappentext) entlarven. Rasch wird noch das Attribut »schlagfertig« hinzugefügt und die einzelnen Mythen, die dekonstruiert werden sollen, aufgeführt. Wobei man irgendwann fragt, ob die Autorin nur die Mythen zerstört, die sie selber geschaffen hat. Aber gemach.
Nun sind (oder waren?) die Verheissungen des »globalen Dorfs«, des mobilen Zeitgenossen und der so einfachen Handhabbarkeit des virtuellen Wissens ja durchaus enorm. Technikaffine Entwickler versprechen uns à la longue immer noch das schöne, gute, einfache – das bessere Leben. Aber so manches Versprechen hat sich schon als veritable Luftblase entpuppt. Man glaubt ja längst nicht mehr an das einzig weißmachende Waschmittel. So können, ja müssen, die Entwicklungen der veränderten Kommunikationsgewohnheiten beispielsweise in Unternehmen durchaus befragt werden. Und ob es dauerhaft erstrebenswert ist an fast jedem öffentlichen Ort die intimen Gespräche anderer unfreiwillig mit zu hören, ist eine durchaus diskutable Frage.
Journalistenattrappen (3)
Das Interview von Horst Seehofer in der Wochenzeitung »DIE ZEIT« hat der bayerischen Staatsregierung so gut gefallen, dass sie es gleich ins Internet gestellt hat. Die Google-Suche verzeichnet es vor dem originären »ZEIT«-Text.

