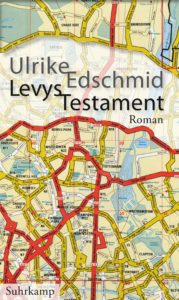Rasch kommen sie, die Analogien. Da ist der furiose Roman »Zone« von Matthias Énard, der 2010 ins Deutsche übersetzt wurde. Der Text entsteht im Kopf eines ehemaligen Söldners während einer Zugfahrt von Mailand nach Rom; ein einziger innerer Monolog einer zwielichtigen Figur (vielleicht ein Kriegsverbrecher?) mit wilden Assoziationen, historiographischen Einschüben, Gedankenketten, (Liebes-)Beichten, Götterbeschwörungen, Schimpf‑, Hass‑, Ekel- und Schmähtiraden, eine Bleiwüste auf 600 Seiten aus nur wenigen Sätzen, vielleicht drei oder vier, einer Revue der Barbaren, die am und um das Mittelmeer in den letzten tausend Jahren gehaust, geherrscht, gevögelt und vor allem gemordet haben, eine unendliche Geschichtsstunde, die man so schnell nicht vergessen wird und die man nicht aufhören kann zu lesen.
Daran denkt man sofort wenn man »Herscht 07769« zu lesen beginnt, diesen Monumentalroman des 1954 geborenen László Krasznahorkai. Leider wurde man inzwischen vorgewarnt, dass diese rund 400 Seiten tatsächlich nur aus einem Satz bestehen. Ein Apokalyptiker sei der Autor, so lese ich, der noch nie etwas von ihm gelesen hatte, so als sei dies in diesen hysterischen Zeiten, die inzwischen in nahezu jeder Nachrichtensendung kleinere und große Apokalypsen in Aussicht stellt, noch etwas Besonderes. Aber dies hier sei ein deutscher Roman sagt einer derjenigen, dessen literarische Urteile ich schätze, und es geht tatsächlich um Deutschland, genauer um Thüringen, den Ort Kana mit der Postleitzahl 07769, den es natürlich nicht gibt, es ist ein fiktiver, ein verwunschener Ort im Osten, den irgendwie alle kennen, obwohl kaum jemand dort war, ein Synonym für Ostdeutschland, wie man es sich vorstellt, denn »Kana machte nachts nicht den Eindruck eines Ortes, an dem die Menschen schön ruhig schliefen, sondern den eines, aus dem man schon weggezogen war«. Später wird man merken, dass der Name nicht nur ein Wortspiel zum real existierenden Ort Kahla ist (Postleitzahl 07766), sondern natürlich auch an das Land Kanaan erinnert, in dem wahlweise Milch und Honig fließen oder (und) Jesus Wasser in Wein verwandelte. Diese Assoziation wird ein bisschen eingehegt, denn die ganze Topographie Thüringens in diesem Buch kommt mit »Klarnamen« vor, also ist das Drumherum erst einmal authentisch (wie es die Kritik liebt).