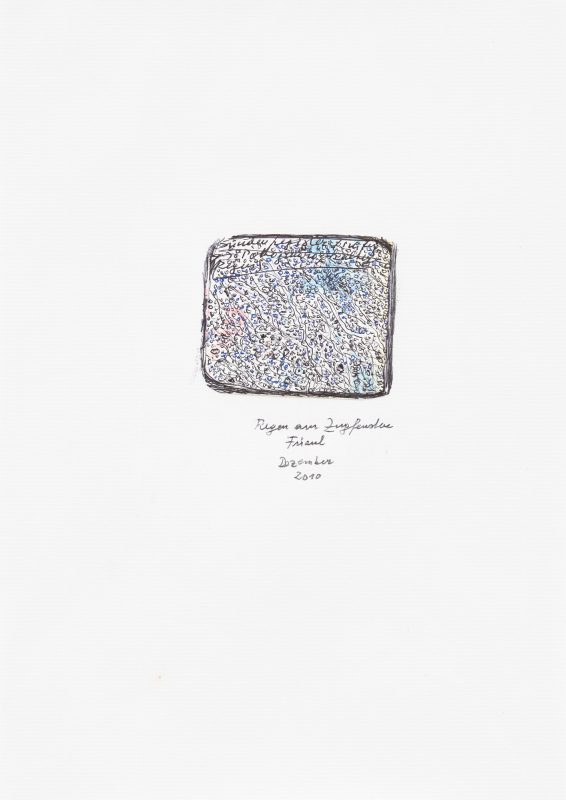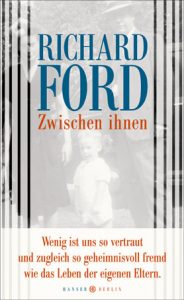1. Bei sporadischen Lektüren von akademischen Aufsätzen zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, besonders zu solcher mit sogenanntem Migrationshintergrund, ist mir aufgefallen, daß in den letzten Jahren die Vorsilbe »trans-« an Häufigkeit gewonnen hat im Verhältnis zur Vorsilbe »inter-«, die sie manchmal ersetzt. »Trans-« verweist auf Bewegung, auf Dynamik; »inter-« auf ein Dazwischen, auf Beziehungen, die zwar nicht ohne Bewegung stattfinden, aber doch erstarren können, so daß sie zu Konstellationen werden. Es ist eine Frage des Akzents, der Aufmerksamkeitsrichtung, der in den Blick genommenen Aspekte. Ich selbst bin, ohne mich in meinem Tun und Lassen ständig sprachkritisch zu reflektieren (und ohne akademische Absichten), auf den Begriff der Transversalität gekommen, um bestimmten Erfahrungen des Schreibens, Lesens und Lebens Ausdruck zu verleihen. Es ist möglich, daß sich im mikrostrukturellen Paradigmenwechsel etwas vom Zeitgeist spiegelt; ja, daß es sich letztlich nur um terminologische Moden handelt. Niemand ist darüber erhaben, aber eine Aufgabe des Schriftstellers besteht darin, ein Sensorium für solche Vorgänge zu entwickeln und zur Geltung zu bringen.
2. Es ist nicht Aufgabe des Schriftstellers, Begriffe zu definieren, gegeneinander abzugrenzen und Begriffshierarchien zu errichten. Auf der Hand liegt, daß in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Autoren und Werke an Zahl und Bedeutung zugenommen haben, die auf unterschiedliche Weise mit Ortswechseln, Reisen, Erfahrung des Fremden, Behauptung des Eigenen in fremder Umgebung, Berührung und Vermischung von Kulturen, Infragestellung von Identitäten usw. zu tun haben. Es gibt dabei freilich, wie bei anderen Phänomenen, etwa der technologisch beschleunigten Globalisierung, eine lange Vorgeschichte. Unter Germanisten war in der Zeit, als ich studierte, die Exilliteratur beliebt. Sie wurde durchforstet, ob ausreichend oder nicht, sei dahingestellt. Heute haben sich die Blickwinkel geändert, das deutschsprachige Exil ist in historische Ferne gerückt, umgekehrt sind Autoren aus anderen Weltgegenden in Erscheinung getreten, die die heimische Literatursprache bereichert haben und bereichern. Bertolt Brecht, Thomas Mann, Joseph Roth haben die Sprache nicht gewechselt, aus mehreren Gründen, vor allen Dingen lag es nicht in ihrer Absicht, ein neues Zielpublikum anzusprechen, außerdem ist ein Sprachwechsel im fortgeschrittenen Alter aufwändig, schwierig bis unmöglich. (Es gibt Beispiele wie Arthur Koestler und Stefan Heym, für die das nicht gilt. Beide sind in relativ jungen Jahren emigriert.) Weiterlesen