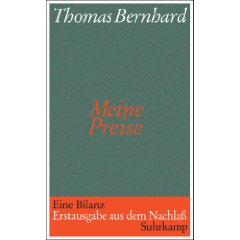Eine neue Studie zur »Lage der Integration in Deutschland«, diesmal vom »Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung« herausgegeben sorgte bereits gestern in Vorabmeldungen für einigen Wirbel. In der Studie »Ungenutze Potenziale« Kurzzusammenfassung, pdf wird ein »Integrations-Index« ermittelt und eine separate Beurteilung der Integrationserfolge nach Herkunftsgruppen vorgenommen.
Die ernüchternde Bilanz: »Zum Teil massive Integrationsmängel bestehen dagegen bei Migranten…vor allem bei der aus der Türkei. Von den hier lebenden 2,8 Millionen Türkischstämmigen ist knapp die Hälfte schon in Deutschland geboren. Diese zweite Generation schafft es jedoch kaum, die Defizite der meist gering gebildeten Zugewanderten aus den Zeiten der Gastarbeiteranwerbung auszugleichen. So sind auch noch unter den in Deutschland geborenen 15- bis 64-Jährigen zehn Prozent ohne jeden Bildungsabschluss – siebenmal mehr als unter den Einheimischen dieser Altersklasse. Dementsprechend schwach fällt ihre Integration in den Arbeitsmarkt aus.« (Quelle: Abstract der Studie – pdf)