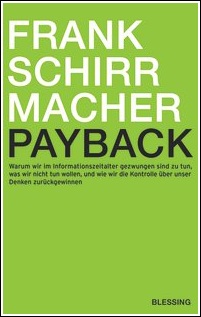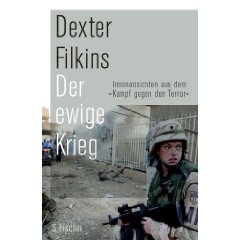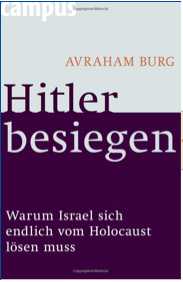Ein Buch wie eine Hilfeschrei. Hier schreibt einer, der getrieben ist von einer besseren Welt. Getrieben von dem Aufsprengen eines Teufelsreises mit den Mitteln der Einsicht, des Arguments – und der Empathie. Der Autor ist Avraham Burg, 1955 geboren, ehemaliger Offizier in einer Fallschirmjägereinheit, ehemaliger Vorsitzender der »Jewish Agency« und ehemaliger Knesset-Sprecher (ein vielfach »Ehemaliger« also). Burg ist Sohn eines »Jeckes«, eines Dresdner Universitätsprofessors, der in Deutschland blieb so lange es eben ging, für eine Unterorganisation des Mossad in Paris illegale Einwanderer herausschmuggelte und dafür sogar mit NS-Offizieren verhandelte und später Minister in mehreren israelischer Regierungen wurde und einer arabischen Jüdin, die als Kind nur mit Glück und Hilfe (ihres arabischen Vermieters) dem Hebron-Massaker 1929 entkam. Dieses Buch will er auch verstanden wissen als Gespräch mit seinem (verstorbenen) Vater und als Dialoggrundlage für seine Kinder (uns es gibt berührende Momente der Annäherung und der Bewunderung seinen Eltern gegenüber).
* * * * *
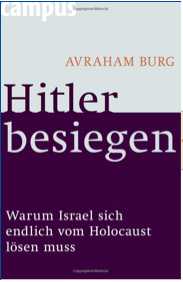
Avraham Burg: Hitler besiegen
Von Johannes Rau stammt der Satz: »Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet.« Genau um diese Differenz geht es in dem Buch »Hitler besiegen«: Burg ist ein Patriot, der sich gegen das nationalistisch werdende, sich isolationistisch gebärdende und dabei mehr und mehr in Paranoia verfallende Israel positioniert und stattdessen seine, die Werte seiner Familie, die Werte der Gründerväter, die Werte eines modernen, neuen Judentums, setzen möchte.
Weiterlesen

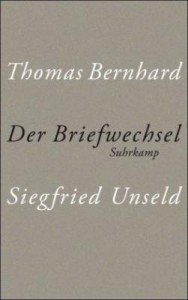 Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.
Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.