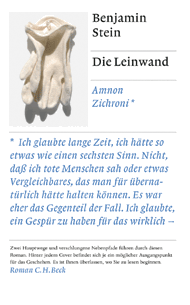««< Folge III – Folge II – Folge I
Acht: Lyrische Gattungen; mit Schwerpunkt auf dem Liebeslied sowie einem Exkurs über den Umgang mit Liebesleid und über andine Hochzeitsbräuche.
Da uns die Chronisten Gebete und Hymnen in Prosa übersetzt haben, zweifeln manche Autoren an, dass der Vers überhaupt existiert hat. Dies steht nun für mich ausser Frage; man weiss nur nicht, inwieweit die Übertragungen an spanische Metren angepasst wurden. Garcilaso spricht von „kurzen und langen Versen“ und von „Silben als Mass“. Weiter sagt Garcilaso: „No usaron de consonante en los versos, todos eran sueltos.” Ich kann mir darauf nur einen Reim machen, wenn ich “consonante” als “Gleichklang“ übersetze, was dann hiesse, dass kein Reim verwendet wurde. Weiterlesen