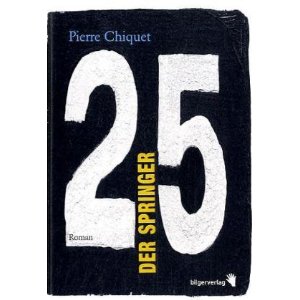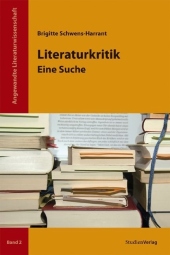Es ist schon erstaunlich, wie sich Geschichte wiederholt. 1991, 1999, 2001, 2003 und jetzt 2011. Es sind Jahreszahlen der markantesten militärischen Interventionen des »Westens«. Man kann auch Krieg sagen, aber das klingt nicht so gut.
So unterschiedlich die Fälle sind und so differenziert man die Eingriffe bewerten muss – die medialen Muster, wie sich diese Konflikte darstellen, sind absolut identisch: Zunächst gibt es einen seit Jahren agierenden Autokraten (oder Diktator) in einem Land. Dieser tut irgendwann etwas, was sichtbar gegen unsere Vorstellungen von Moral verstößt. Wohl gemerkt: Er muss es sichtbar tun. Es reicht nicht, wenn er jahrzehntelang Abtrünnige in Gefängnissen foltern und umbringen lässt. Es reicht nicht, wenn er einen Geheimdienstapparat unterhält, der repressiv gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Es reicht auch nicht, wenn in wenigen Wochen bis zu einer Million Menschen umgebracht werden, und es ist keine Kamera dabei. Es muss etwas geschehen, was in die gängige Bilderwelt unserer Medien einfließt und als schrecklich, grausam, brutal oder menschenverachtend bezeichnet werden kann. Sogleich wird diese Figur zur persona non grata. Sogenannte Intellektuelle stellen dann Vergleiche an. Der griffigste Vergleich ist immer noch der mit Hitler. Oder er ist einfach ein »Irrer«. In jedem Fall ein »Schlächter«. Oder alles gleichzeitig.
Schnell finden sich willige Interventionisten. Die Neokonservativen der USA der 1970–2000er Jahre und die Grünen Europas sind in ihrem Interventionismus sehr ähnlich. Beide vertreten die Ideologie, dass am westlichen Wesen die Welt genesen muss. Schnell potenzieren sich die Ereignisse durch willige Helfer in den Medien zum scheinbar alternativlosen Handeln. Gegenargumente werden mit der Billigung der Taten des Despoten einfach gleichgesetzt. Der abtrünnige Standpunkt wird denunziert – darin sind sie denjenigen, die sie bekämpfen wollen, durchaus ebenbürtig. Es gibt nur noch schwarz oder weiß – wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Weiterlesen