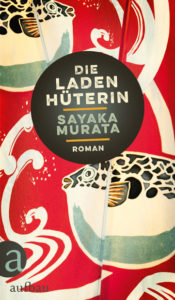Im Zug die üblichen Samstagnachmittag-Baseballfans in ihren roten T‑Shirts, roten Kappen, roten Cardigans, roten Taschen, roten Socken, roten Schlapfen, alles rot, nur die Hosen nicht, bei den Hosen ist grün in Mode, das merkt man auch hier. Ah, mein Buch paßt dazu, die Fahrtlektüre, ein Roman von Philip Roth, natürlich in Rot. Dann Straßenbahn, Einkaufsstraße, Shoutengai, Parco, das Kaufhaus für junge Leute, wo ich früher oft einkaufen war, als ich mich noch halbwegs jung fühlte, plaudern mit meiner Lieblingsverkäuferin, die ich neulich vor einem Café getroffen habe, sie arbeitet schon lange nicht mehr in der Boutique.
»Und jetzt?«
»Hier in der Gegend.«
»Da gibt es doch nichts.«
Sie hat sich schon früher für schicke Autos interessiert, und hier, wo es nichts gibt, gibt es nicht wenige Zulieferungsfirmen für Matsuda, auf deutsch Mazda.
Wir lachten, gingen unserer Wege. Die Boutique im Parco ist nicht mehr das, was sie war. Die Geschäftsleitung der Kette, zu der sie gehört, wollten sie noch mehr verjüngen, jetzt stehen dort dämliche Jungs mit toupierten Frisuren als Verkäufer herum, lebende Schaufensterpuppen, wenig Kunden. Ich muß ohnehin in den zehnten Stock, den letzten. Club Quattro, hätte ich im Keller erwartet, Google Maps spezifiziert das nicht, ist aber oben über den Dächern der Stadt. Was man dann gar nicht merkt, wenn man einmal drin ist in der Bude. Fensterlose Säle dieser Art haben allesamt etwas von den alten Beat-Kellern, Gott hab sie selig. Kühl, gedämpft, nicht zu groß nicht zu klein, vorne Stehpublikum, hinten Sitzplätze an zwei langen Theken. An den Seitenwänden drei vergrößerte Fotos, die wie Vorhänge wirken, rechts die Szenerie des zerstörten Hiroshima im August 1945, darunter ein neues Foto desselben Orts, die Dächer der Stadt, wie man sie vom Parco aus sieht, links ein sofort als solches erkennbares Kunstwerk, eine Collage, die linke Hälfte des Fotos sehr bunt, die rechte dunkel, überwiegend schwarz wegen der alten Leute, die da in Trauerkleidung auf dem Boden liegen, sich dabei aber, nach ihrer Mimik zu schließen, recht gut amüsieren. Auf der linken Hälfte stehen und liegen und krabbeln fast nackte, nur mit Windeln bekleidete Babys auf der grünen Wiese, ein paar Tiere sind auch da, eine große Schildkröte, ein Fuchs, ein kleines Nashorn, und in der Mitte des Ganzen, schwarz-weiß oder grau-weiß, der Atompilz, das Zentralmotiv der ganzen Anordnung. Leben und Tod? Leben und Leben. Oder Leben und Tod und noch immer Leben.
Ach ja, das Konzert findet am 6. August statt, nicht um 8 Uhr 15, sondern am Abend. Abgesehen von den Vorhangfotos, die bald im Dunkel verschwinden werden, ist nicht viel davon zu merken. Der Moderator sagt pflichtschuldig ein paar Worte, auch die Jüngeren, auch die Alternativen sollen an diesem Tag daran erinnert werden und nicht vergessen, daß es immer noch Atomwaffen gibt und Kriege geführt werden.
»Wart ihr um acht Uhr schon wach? Habt ihr die Ansprachen gehört? Im Fernsehen, ja? Nein? Macht nichts.«
Weiterlesen ...