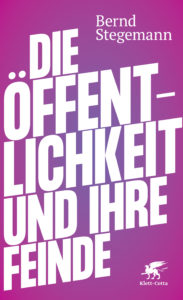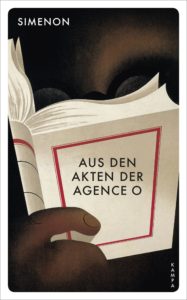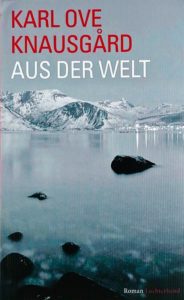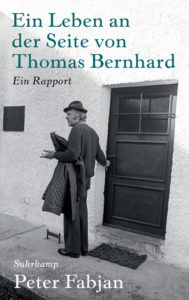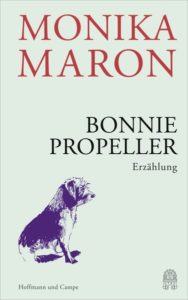2013 legte der Autor Malte Herwig eine eindrucksvoll recherchierte Studie zur sogenannten »Flakhelfer«- Generation vor, aus der hervorging, dass etliche derjenigen, die man (vollkommen zu Recht) als die Säulen der neuen, demokratischen und pluralistischen Bundesrepublik bezeichnete, mit 17 oder 18 Jahren, also 1944 und auch noch 1945, Mitglied in der NSDAP geworden waren. Und dies, so das Ergebnis der Nachforschungen, mit ihrem jeweils ausdrücklichem Wissen, da es keine »automatischen« Parteimitgliedschaften gab. Herwig ging es dabei nicht um die Diffamierung der Lebensleistung von Menschen wie Hans-Dietrich Genscher, Dieter Hildebrandt, Walter Jens oder Dieter Wellershoff (um nur einige zu nennen). Was ihn umtrieb war das behauptete oder womöglich im Laufe der Zeit tatsächlich eingetretene Vergessen. Selbst eindeutige Belege vermochten bei den meisten kein Einsehen zu erzeugen. Die Empörung der Bewunderer der Protagonisten ließ er nicht gelten. Biografien dürften nicht geglättet werden, sie sollten gerade in ihrer Widersprüchlichkeit gezeigt werden, um die Leistungen danach richtig beurteilen zu können.
Hatten sie nach 1945 überhaupt eine andere Wahl als das Schweigen? Was wäre aus einem Günter Grass geworden, wenn er beispielsweise innerhalb der Gruppe 47 seine Dienstzeit in einer SS-Panzerdivision freimütig zugegeben hätte? Hätte Hans-Dietrich Genscher Innen- und später Außenminister werden können, wenn seine NSDAP-Mitgliedschaft bekannt geworden wäre? War das Engagement für die neue deutsche Demokratie eine Form der Sühne, eine Form der Buße im Angesicht einer lebenslang empfundenen und/oder später verdrängten Scham?
Herwig scheint fasziniert zu sein von dieser Form der Verwandlungsfähigkeit von Menschen. Einige Jahre später verantwortete er einen wunderbaren Podcast über die sogenannten Hitler-Tagebücher. Der Verwandlungskünstler hieß diesmal Konrad Kujau, der sich als imaginärer Adolf Hitler in eine Art Rausch geschrieben hatte. Aufklärerisch wollte dieser Fälscher nicht wirken, sondern nur sein Vermögen aufbessern. Daher betrog er. Die Opfer waren zunächst ein gutgläubiger Journalist, der die Story seines Lebens witterte und ein paar Blattmacher. Später dann Millionen Leser.
Und nun legt der Thomas-Mann-Kenner und Peter-Handke-Biograph Malte Herwig eine Lebensbeschreibung über einen gewissen Helmut Schreiber vor, der sich einst »Kala Nag« und dann, in den 1950er Jahren, »Der große Kalanag« nannte.