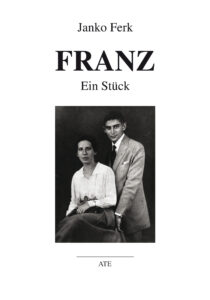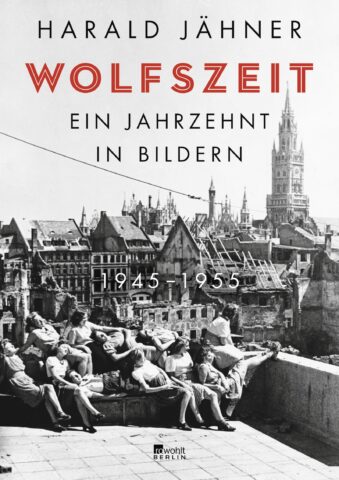Es beginnt mit einer melancholischen Erinnerung an eine Aufführung seiner Theater AG von Thornton Wilders Unsere kleine Stadt. Ein »sanftes Drama« über Liebe und Leid statt Gier und Angst nennt Simon Strauß dieses Stück von 1938, ein »Gleichnis über das Glück der Dauer«. Andere würden es eine Hommage an die Provinz nennen. Strauß nimmt es als Vorlage zu Überlegungen über das politische Miteinander in einer globalisierten, unübersichtlichen Welt jenseits fest zementierter Meinungskorridore. In der Nähe heißt das Buch des Romanciers und FAZ-Redakteurs und es ist eine Mischung aus Reportage, Streitschrift, Manifest und bisweilen sogar Utopie.
Grover’s Ryle, die kleine Stadt bei Wilder, ist ein Ort der Gemeinschaft, eine kleine »Polis«. In der Antike bestanden Städte aus rund 20.000 Menschen, ähnlich dem Ort im Stück. Die Stadt ist ein ur-politisches Phänomen; sie besteht aus Bürgern (darin ist das Wort Burg enthalten). Diese kennen sich, kümmern sich, arrangieren sich. Strauß ist 1988 geboren, wuchs in der Uckermark auf. Die Dichotomie zu Ost gegen West bekam er überliefert. Interessant, wenn er erzählt, wie unbedarft man einst eine LPG-Fahne als Zeltdecke benutzt habe. Erst während eines Internatsaufenthalts in Neuseeland, im Spott der »Farming Boys«, die ihn mit Hitler-Gruß und Fragen nach der Mauer konfrontierten, änderte sich das.
Das »Banden-Gefühl«, das sich während der Theater AG entwickelte, war rasch vorbei. Nach dem Abitur kam das schnelle »Aus-den-Augen-verlieren«. Auch Strauß jettete für Bildung und Beruf umher. Aber die Idee der Gemeinschaft, wie sie sich in Wilders Stück zeigt, lässt ihn nicht los. Strauß wohnt in Berlin und in der Uckermark; in der Nähe liegt Prenzlau, nicht zu verwechseln mit dem Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, jener »Modekiez, dessen gutsituierte Doppelmoral gerne mit Lastenrad und Privatschulbesuch charakterisiert wird«. Prenzlau hat Polis-Größe, wurde erstmals 1138 erwähnt, hatte in ihrer Blütezeit sieben Kirchen und drei Klöster und galt im 15. Jahrhundert als »Hauptstadt der Uckermark«. Zwei Jahre wird Simon Strauß diesen Ort immer wieder besuchen, als »Bürger in der Nachbarschaft, der sich für eine Frage besonders interessiert: Wie ist im Zeichen wachsender Selbstgerechtigkeit und digital befeuerter Schmählust noch Gemeinschaft möglich?«