Im rumpelnden Zug das Tal hinunter, das zuerst einmal eine Schlucht ist, bevor es sich weitet und die Gebäude zunehmen, wollte ich die Landschaft und was darin vorkommt, allerlei Dinge und Wesen, mit den Augen meiner Tochter betrachten, die hier täglich außer sonntags ihren Schulweg hinter sich bringt, aber dann wurde mir bewußt, daß sie ihr Smartphone bei sich hat und sicher die meiste Zeit darauf starrt wie die anderen Schüler auch, wenn sie nicht gerade schlafen, aber das eher nicht, denn die Plätze sind zu diesen Zeiten, morgens und abends, besetzt, da müßte sie schon im Stehen schlafen. Es ist der gewohnte Blick der Pendler, denke ich, der oberflächliche Smartphoneblick, der die Bilder fortwischt, sofern sie sich nicht von selbst bewegen, die bewegten und unbewegten Bilder, fort- und herbeibugsiert im Nu; oder der schwarze Blick des Schlafs, der graue des Dösens; oder der Blick nach innen, wo die Träume hausen. Bloß keine Wirklichkeit! Die sich sowieso in einem Satz beschreiben läßt: grünes Gewucher, grauer Beton, Blinken von Wasser, Karosserien und Lichtreflexen. Punkt. Am Ende doch wieder dasselbe wie die Bilderflut am Display.
Jahr: 2022
Neues von Elfriede Jelinek
Vor wenigen Wochen wurde die österreichische Schriftstellerin und Dramatikerin Elfriede Jelinek 76 Jahre alt. Mit wohltuender Anlasslosigkeit kommt nun ein Film der Berliner Dokumentarfilmerin Claudia Müller mit dem schönen Titel »Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen« in die Kinos. Müller ist durch ihre Fernseharbeiten u. a. über Jenny Holzer, Katharina Grosse und ...
Gabriele Riedle: In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg.
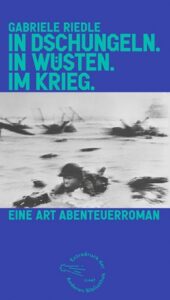
In Wüsten. Im Krieg.
In Nicolas Borns Roman »Die Fälschung« von 1979 sitzt der Reporter Laschen, der vom libanesischen Bürgerkrieg berichtet, täglich zusammen mit anderen Journalisten in einem Hotel und sortiert die jeweiligen Pressemitteilungen der Kriegsparteien. Der Publikationsdruck zwingt ihn Propagandamaterial zu lesen, Fotos zu machen, Interviews zu führen, unzuverlässige Augenzeugen zu befragen. Für Ortstermine außerhalb des Schutzraums Hotel sind die Journalisten auf zuverlässige Übersetzer und vor allem das Goodwill der jeweiligen Warlords und deren Schutz angewiesen. Dabei weiß Laschen, dass er immer droht, von einer Seite vereinnahmt zu werden und doch versucht er, so etwas wie die Wirklichkeit einzufangen.
Joris Luyendijk, Arabist und Korrespondent des niederländischen Fernsehens von 1998 bis 2003, beschrieb 2007 in seinem Buch »Wie im echten Leben« desillusioniert die Unmöglichkeit einer auch nur halbwegs objektiven Berichterstattung. Der Reporter würde zerrieben zwischen der Propaganda der unterschiedlichen Parteien. Von seinen Auftraggebern blieb immer weniger Raum für die ausführliche Darstellung von Konfliktlinien; es galt, die schnelle, knallige Schlagzeile zu liefern. Komplexe Sachverhalte werden eingedampft. Die Entscheidung, was gesendet, was wie gedruckt wird, treffen andere.
Weitere Kriege und ein paar Digitalmedien weiter lassen Kriegs- und Krisenberichterstatter als die letzten Abenteurer der Welt neu auffrischen. Derweil sich die einstigen Printreporter immer mehr darauf verlegen, ihre Erlebnisse in einen fiktionalen Text zu transformieren. Sie changieren häufig zwischen Vermächtnis, Heldengeschichte, Melancholie oder Resignation über die Schlechtheit der Welt und die Unbelehrbarkeit der Menschen. Manchmal schwingt noch das Bedürfnis mit, einen Schlüsselroman zu schreiben, um die Neugier des Rezipienten auf Medieninterna zu lenken, sofern die entsprechenden Protagonisten bekannt genug sind.
Moritz Baßler: Populärer Realismus
Im letzten Jahr sorgte ein Aufsatz des Literaturwissenschaftlers Moritz Baßler über den »neuen Midcult« für einiges Aufsehen in der Literaturszene. Kurz darauf folgte zusammen mit Heinz Drügh das Buch »Gegenwartsästhetik«. Es war der Versuch einer Analyse der aktuellen Literatur im Kosmos des Marktes. Hier fügte sich schließlich die Midcult-These ein, die eine Art Purgatorium des ...
Helena Adler: Fretten

Vor zwei Jahren wurde Helena Adler einem breiten Publikum mit ihrem furiosen Debut »Die Infantin trägt den Scheitel links« bekannt. Mit »Fretten« liegt nun der zweite Roman vor, der im Vergleich zum Erstling noch mehr an der Schraube der Expressivität, der Wut aber auch der Zärtlichkeit dreht, etwas, was man kaum für möglich gehalten hat. Aber gemach.
Zu Beginn wird die Vokabel »fretten« erklärt: »sich abmühen, sich plagen […] sich wund reiben«. Wie schon in der »Infantin« sind die 21 Kapitel des neuen Romans überschrieben mit Titeln von Kunstwerken; zumeist Gemälden (deren Anschauen zur Lektüre lohnend ist), aber auch eine Performance und zwei Installationen der Autorin, die man nur erahnen kann. Auch inhaltlich könnte »Fretten« eine Fortschreibung des Erstlings sein; es gibt angedeutete Parallelen zur Eltern- und Großelterngeschichte, die aber nicht mehr weiter ausgeführt werden. Die »Infantin« endet mit dem Abschied von Kindheit und Jugend; sie legte »ihre Waffen nieder« und stillte ihr Kind. Und die Ich-Erzählerin aus »Fretten« stellt ab Mitte des Romans die Geburt und die Betreuung ihres Sohnes in den Mittelpunkt. Dann nimmt das richtig Fahrt auf.
Zunächst jedoch wird die Kindheit als »irdisches Paradies« erzählt, ein bukolisches Idyll mit imaginierten warmen Dämpfen; eine »weiche Welt« im »Blumenversteck« des verwilderten Großelterngartens mit Blick auf die Berge, die ein »unendliches Meer« »inszenierten«. Jeder Tag »roch nach Abenteuer«. Noch war es da, das »Urvertrauen« und eine strotzende Lebensgier erfüllte sie. Es gab den »Duft unserer Weizenfelder« (das Olfaktorische spielt in diesem Buch eine wichtige Rolle) und die »Abendsonne stichelt goldgelb in die Alpensavanne« während die Schatten ein Bild lieferten, »als würde das Land mit Erdöl geflutet.«
Es sind Evokationen aus den »Gefilde[n] der Seligen« und ich frage mich, wann ich zuletzt derart zauberhaftes gelesen habe (das ist lange her). Aber das ist nur die eine Seite. Daneben, gleichzeitig, gab es auch das Lebens in der harten, »brutalen Welt« der Eltern, diese Kadaver- und Verwesungsgerüche – eine Metapher für Unverständnis und Borniertheit – und am liebsten war die Erzählerin mit sich alleine, beim Zeichnen von Bestiarien mit den »Monstern der Nacht« und später wurde die »Sprache der Phrasendrescher« (vulgo: Familie) »zerhäckselt«.
Richard David Precht / Harald Welzer: Die vierte Gewalt
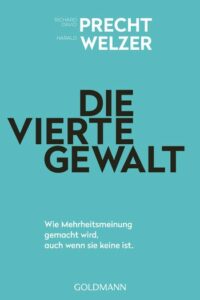
Die vierte Gewalt
Wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung des Buches »Die vierte Gewalt« schlug den beiden Autoren für ihr Werk eine große Portion Häme und Unverständnis entgegen. Grund waren vor allem die für das Buchmarketing vorgenommenen (und von den Leitmedien bereitwillig geführten) Interviews, in dem beide (oder auch nur einer von beiden) vor allem ihre Position zum Russland-Ukraine-Krieg und den deutschen Waffenlieferungen noch einmal pointiert – und teilweise mit großer Arroganz – vorbrachten. Precht und Welzer sind gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine (und zwar generell – nicht nur von Deutschland), weil sie eine Eskalation fürchten. Russland sei, so das Credo, Atommacht. Dass Atommächte in der Vergangenheit durchaus ihre Invasionen aufgrund zu hoher Gegenwehr abgebrochen haben, scheinen sie nicht zu wissen. Stattdessen schlagen sie Verhandlungen mit Putin vor, obwohl dessen Regime die Bedingungen hierfür mehrfach erklärt hat: Hierzu wäre die Kapitulation der Ukraine notwendig.
Mehrfach haben Precht wie auch Welzer (hier der Einfachheit halber mit der Sigle »WP« abgekürzt) in »Offenen Briefen« zur Einstellung der militärischen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Dies und das aggressive Marketing führt zu fulminantem Widerspruch insbesondere in den sogenannten sozialen Medien (Twitter, Facebook). Dass die überwältigende Mehrzahl der Kritiker das Buch bis dahin nicht gelesen hatten (bzw. es nicht lesen konnten) spielt keine Rolle. Man schloss schlichtweg vom Inhalt der bisherigen Statements von WP auf das Buch.
Omnipräsente Darlings
Beide Autoren sind seit vielen Jahren publizistisch omnipräsent und man kann sie als Darlings des Medienbetriebs bezeichnen. Harald Welzer, Autor zahlreicher Bücher ist eine bekannte Figur der sich progressiv gebenden Degrowth-Bewegung und gerngesehener Gast in den Medien. Richard David Prechts Karriere verdankt sich vor allem dem öffentlich-rechtlichen System: es war die Literaturkritikerin Elke Heidenreich, die sein Buch »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?« derart emphatisch lobte, dass es praktisch über Nacht zum Beststeller wurde. Zuschauer von populärwissenschaftlichen Sendungen konnten von da an dem sogenannten Philosophen Precht schwer entkommen; seine Bücher wurden stets in entsprechenden Sendungen »vorgestellt« (Euphemismus für beworben) und erreichten dementsprechend hohe Verkaufszahlen. Tatsächlich hat Precht keinen einzigen philosophischen Forschungsbeitrag publiziert und spielt in der akademischen Philosophie keine Rolle.
Nun haben also WP ein Buch geschrieben, in dem sie unter anderem beklagen, dass die so wichtig gewordenen Talkshowrunden im deutschen Fernsehen nicht paritätisch nach Umfrageergebnissen besetzt sind. Weil sie herausgefunden haben, dass im Frühjahr bis zu 46% der befragten deutschen Bevölkerung gegen Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gewesen sind, leiten die beiden daraus ab, dass Diskurse dieses (schwankende) Stimmungsbild jedes Mal abzubilden haben. Man sollte also keine Militärexperten, Geopolitikwissenschaftler oder Russlandforscher einladen, sondern, so wird suggeriert, vermehrt wissensferne Akteure, deren einzige Qualifikation darin besteht, eine bestimmte Meinungsquote zu erfüllen.
Interessant ist dabei, dass diese Diskussionsrunden von WP wie eine Art Ringkampf betrachtet werden, in dem es nur »pro« oder »contra« gibt. Zwar beklagen die beiden im Laufe des Buches exakt diese binäre Ausrichtung und setzen sich (etwas obskur formuliert) für »mehr als fünfzig Schattierungen von Grau« (wer kommt da nicht auf einen Buchtitel?) ein, die »nicht angemessen repräsentiert« seien – aber man selber betreibt das »Entweder-Oder«-Spiel sehr häufig.
Jochen Hörisch: Poesie und Politik
Die zahlreichen Publikationen wie beispielsweise die Kulturgeschichte der Hände (2021), die Monografie »Gott, Geld und Medien« (2004), ein Essay über das »Wissen der Literatur« (2007), Martin Luther (2020), Richard Wagners Theorietheater (2015) oder der »Wut des Verstehens« (1988/2011) machen Jochen Hörisch (Jahrgang 1951) zu einer gerne befragten Persönlichkeit. Er erscheint dabei wie eine Art kulturwissenschaftlicher ...
Carlo Masala: Weltunordnung
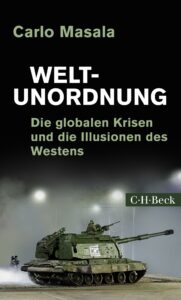
Weltunordnung
Die Publikationsgeschichte des Buchs »Weltunordnung« von Carlo Masala bestätigt indirekt die sich im Titel ausdrückende Feststellung. Die erste Auflage erschien 2016. Zwei Jahre danach eine aktualisierte Version. Und jetzt, 2022, nach der Invasion der Ukraine durch Russland, erscheint eine dritte, abermals aktualisierte und um ein Kapitel ergänzte Auflage. So werden Befunde des Autors belegt und noch vor kurzer Zeit für unmöglich gehaltene Entwicklungen werden plötzlich Realität.
Carlo Masala, 1968 geboren, ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch die militärische und geopolitische Kommentierung des Kriegs Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 bekannt. Sein Idealismus dem argumentativen Austausch gegenüber ist so groß, dass er sich bisweilen sogar ins Dilettantengetümmel der Polittalkshows stürzt. Wer sich dies ersparen möchte, kann immerhin noch dieses Buch lesen. Und es lohnt sich.
Die Arbeitshypothese ist schnell formuliert: Die Zeitenwende 1989/90 mit dem Zusammenbruch des bipolaren Systems (USA vs UdSSR bzw. NATO vs Warschauer Pakt) hat nach einem kurzzeitigen Honeymoon (»Ende der Geschichte«) zu einer veritablen weltpolitischen Unordnung geführt. Aber, so stellt Masala kühl fest: »Die Versuche der ‘westlichen’ Welt […] eine neue globale Ordnung zu schaffen, haben in einem nicht unerheblichen Maße dazu beigetragen, dass wir heute in einer Welt der Unordnung leben.« (»Westlich« wird hier natürlich nicht als geografische sondern als gesellschaftlich-kulturelle Zuordnung verstanden.) Daneben gibt es mit dem internationalen Terrorismus, Migrationsströmen, Cyberangriffen und Pandemien weitere Herausforderungen, die zur Destabilisierung führen.
In den 2000er Jahren wurde die »unilaterale Wende« der amerikanischen Sicherheits- und Außenpolitik durch eine seltsame Allianz aus Neokonservativen und liberalen Demokraten noch verstärkt. Die USA sahen »den Einsatz militärischer Machtmittel als legitimes Instrument […] um ihre globalen Phantasien zu realisieren«. Dabei sind alle Missionierungsversuche, die bisweilen unter dem Euphemismus der »humanitären Intervention« geframt wurden und Demokratie und freie Marktwirtschaft universalisieren sowie die » ‘westliche’ Vorherrschaft über den Rest der Welt« festschreiben sollten, gescheitert. Die Liste ist lang, reicht »von Bosnien-Herzegowina über Afghanistan und den Irak bis hin zu Libyen« (und ist damit noch nicht einmal vollständig). Resultat: Zerfallende Staaten oder bestenfalls eingefrorene Konflikte. Auch die gewaltsame Bekämpfung des islamischen Terrorismus ist nur teilweise gelungen.
Masala belegt dies an zahlreichen Beispielen, analysiert die Doppelmoral des Westens, der Demokratie predigt, aber beispielsweise »falsche« Wahlausgänge (wie in Algerien 1991/92 oder der Türkei 1996) sabotiert oder korrupte, aber ihm gewogene Präsidenten an die Macht hievt (wie in der Vergangenheit in Afghanistan). Schließlich verwirft Masala mit dem »Liberalismus« und der Verrechtlichung der Außen- bzw. Weltpolitik zwei Säulen des aktuellen politischen Denkens.

