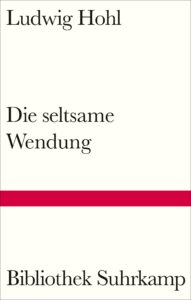
Aus Anlass des 120. Geburtstags von Ludwig Hohl im nächsten Jahr veröffentlicht der Suhrkamp-Verlag unter Kuratierung der Ludwig-Hohl-Stiftung im Rahmen der Bibliothek Suhrkamp-Reihe gleich fünf Texte in vier Büchern des 1980 verstorbenen Schweizer Solitärs. Vier davon sind bisher unveröffentlichte Werke; einer erschien 1949 vom Dichter im Selbstverlag. Während Die seltsame Wendung als Novelle bezeichnet wurde, nannte Hohl die anderen vier »Bericht«. Die Forschung rubriziert die fünf Texte, entstanden zwischen 1929 und 1949, als »geschlossene Gruppe«.
Ludwig Hohl, 1904 geboren, war, wie Peter Bichsel einmal sagte, ein Schriftsteller, der das Pech hatte, zeit seines Lebens »Geheimtip« zu sein. Der Vater war Pfarrer, die Mutter eine Tochter eines Papierfabrikanten. Im Oktober 1924 verließ Hohl mit seiner damaligen Freundin fast fluchtartig die als eng empfundene Welt des großbürgerlichen Elternhauses und zog nach Paris. Er legte den Vornamen Arnold – es war der seines Vaters ab – und nannte sich fortan »Ludwig«. Der junge Hohl verstand sich als Künstler. Kurz zuvor waren einige Gedichte von ihm publiziert worden. Nun also in der Metropole der Kunst, in Paris, in der Nähe des Montparnasse. Aber Hohl fasste schwer Fuß. Von den Eltern gab es nur unregelmäßig Zuwendungen; den Lebensunterhalt verdiente anfangs die Freundin. Er streifte mit seinem Notizbuch durch die Bars und Cafés und rasch kreiste auch die Flasche.
Erfolglosigkeit, Alkohol, die Trennung von der Freundin – in diesem Klima entstand Die seltsame Wendung im Jahr 1929. Der biographische Kontext ist deutlich, auch wenn hier, anders als in den Berichten nicht in der Ich-Form, sondern personal erzählt wird. Hauptfigur ist ein namenlos bleibenden Maler, der sich »im Montparnasse« niederlässt. Zunächst wohnt er in einem Hotel, bekommt von einem Verwalter regelmäßig Geld zugeschickt, welches für eine bestimmte Zeit reichen soll. Später passt er den Geldfluss seinen bisweilen exzessiv ausgelebten Bedürfnissen an, bis schließlich nichts mehr vorhanden ist.


