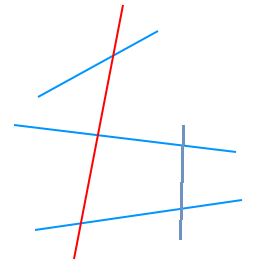Aus traurigem Anlass:
Jungk Peter Stephan
Welten und Zeiten XV
Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Sowohl als Leser wie auch als Schreiber glaube ich bei bestimmten Texten etwas wie Dringlichkeit zu spüren. Seltsamerweise oft bei älteren Texten, und beim Schreiben sozusagen: immer seltener. In der gegenwärtigen Literatur finde ich solche Dringlichkeit kaum. Auch und gerade dann, wenn sich Autoren um möglichst aktuelle Themen bemühen, entsteht der Eindruck von Dringlichkeit nicht, statt dessen ein anderer, nämlich daß sie ein selbst auferlegtes Programm erfüllen, eine Pflicht erledigen. Viele wollen die Bedrohung der Umwelt in den Texten »unterbringen«. In den Erzählungen wird es immer heißer, dort und da brechen Brände aus, aber die Sätze brennen nicht unter den Nägeln.
Warum? Literatur – soll ich sagen: echte Literatur? – ist inaktuell, manchmal sogar antiaktuell. Jene Dringlichkeit, die ich meine, ist zum Beispiel bei Annie Ernaux zu spüren, die sich, jedenfalls in ihren literarischen Texten (was sie über Palästina denkt, hat damit wenig zu tun), nicht um aktuelle Themen kümmert. Ernsthaftigkeit ist ein verwandter Begriff, eine ähnliche Haltung. Ernsthaft kann heißen: durch den Schleier der Sprache zur Wirklichkeit durchdringen wollen. Dringlichkeit und Durchdringen. Weil Sprache, weil unsere Erzählungen, unsere Mythen, die allgemeinen wie die privaten, das Geschehene eher verdecken als enthüllen. Autoren wie Ernaux geht es um das Enthüllen: die Sprache so weit wie möglich zurückschrauben, interpretationslos schreiben, was war. Wahrscheinlich kann es da immer nur Annäherung zeigen. Bei Ernaux besteht das Erzählen im Mitschreiben dieser Annäherung.
Ernsthaftigkeit ist aber nicht alles, sie hat einen ehrenwerten Opponenten: die Verspieltheit. »Verspieltheit« klingt abwertend, ist aber nicht so gemeint. Spielerische Erzählliteratur, und nicht nur sprachspielerische, sondern mit Erzählelementen und Bildern spielende, trägt ihre raison d’être in sich, sie ist Selbstzweck, man muß sie nicht rechtfertigen. Kunst ist ihrer Genese nach eine Form des Spiels, ohne das menschliche Entwicklung nicht möglich ist. Wer Künstler wird oder bleibt, ist bloß mehr Kind geblieben als andere Erwachsene. Dieses spielerische Moment enthalten auch zahllose ernsthafte Erzählungen, etwa die von Peter Stephan Jungk, wobei ich an den autobiographisch-surrealen Roman Die Reise über den Hudson ebenso denke wie an das literarisch-ethnographische Kunstwerk Marktgeflüster. In der österreichischen Literatur gibt es eine besonders stark ausgeprägte Neigung zum spielerischen und verspielten Schreiben: Nestroy, Herzmanovsky-Orlando, die Wiener Gruppe, Ernst Jandl, Franzobel, Helena Adler – um hier nur anzudeuten, was und wen ich im Blick habe. Auch Friederike Mayröcker. Surrealismus bringt die Ordnungen und Ebenen durcheinander und baut neue Ordnungen auf, die wir nicht immer sofort nachvollziehen können oder wollen. Dann lassen wir uns vom Chaos streicheln. Das nenne ich »Spiel«. »Chaosmos«, der von Deleuze geprägte, jedoch von James Joyce geklaute Begriff gefällt mir immer noch, obwohl der Philosoph mittlerweile recht inaktuell geworden ist. Zeit, ihn wieder zu lesen. Chaosmos: die Welt im Zustand ihrer Entstehung.
Peter Stephan Jungk: Marktgeflüster
»Eine verborgene Heimat in Paris« – so lautet der Untertitel von Peter Stephan Jungks neuestem Buch »Marktgeflüster«. Es sind 27 Kapitel, verwoben zu einem autofiktionalen Text (die Bezeichnung »Roman« fehlt), denn der Ich-Erzähler ist deutlich erkennbar als der Autor (auch, wenn man sicher künstlerische Freiheiten attestieren muss). Zoe, die Frau seines Lebens, nach der er ...
Der Lichtsammler und sein Sohn
Eine Begegnung in Hiroshima
Es wird im Jahr 1978 gewesen sein, zu einer Zeit, als an den Universitäten noch ein wenig schöpferische Unruhe zu finden war, da sah ich mich in einer basisdemokratischen Versammlung aufgerufen, meine Stimme für Robert Jungk abzugeben. Der Zukunftsforscher, so wurde er tituliert, sollte eine Professur an der Salzburger Universität erhalten. Natürlich hatte ich von Robert Jungk schon gehört, Bücher wie Der Atomstaat waren den linken Studenten zumindest dem Namen nach bekannt. Hätte ich mich, wie jene Kollegen, die in Bussen von Salzburg nach Zwentendorf gefahren waren, im Widerstand gegen das österreichische Atomkraftwerk engagiert, ich hätte wohl etwas mehr gewußt über den Mann dem weißen Haarschopf, wäre ihm vielleicht sogar über den Weg gelaufen. Aber daß wir uns längst mitten in einer Umweltkrise befanden, die zunehmend dramatisch wurde, war mir damals noch nicht klar. Robert Jungk hingegen war einer der Ersten und Hellsichtigsten, wenn es um ökologische Themen ging. Das weiß ich heute, und genauer weiß ich es auch nur, weil ich unlängst einen Vortrag von Peter Stephan Jungk über seinen Vater gehört habe.
Von Peter Stephan Jungk hatte ich während jener basisdemokratischen Versammlung womöglich ein Buch in der Umhängetasche: Stechpalmenwald, erschienen in der exquisiten Collection S. Fischer. Seltsam, ich kam lange nicht auf den Gedanken, zwischen diesem Autor und dem berühmten Journalisten Robert Jungk einen Zusammenhang herzustellen. Ich glaube tatsächlich, Peter – so nenne ich ihn inzwischen – hatte anscheinend nie mit den Schwierigkeiten zu kämpfen, die sich einstellen können, wenn der Sohn in die Fußstapfen eines berühmten Vaters tritt. Die beiden verstanden einander sehr gut, Peter bezeichnet den Vater als seinen »besten Freund«, an den er noch heute jeden Tag wenigstens einmal denke, aber die Rede im Friedensmuseum von Hiroshima am 3. März 2014 war die erste öffentliche, schriftlich fixierte Äußerung über Robert, der Freunden und Familienmitgliedern »Bob« gerufen wurde.
Das einstöckige, von einem Park umgebene Friedensmuseum wirkt flach, es paßt sich dem Erdboden an, erhebt sich nur wenig über ihn und mimetisiert so die totale Zerstörung, den ground zero, den die Atombombe am 6. August 1945 hinterlassen hat. Zugleich aber wächst hier etwas, die Zerstörung hat nicht das letzte Wort behalten, es wachsen wunderbare Kusu-Bäume, die man in der ersten Nachkriegszeit gepflanzt hat. Als ich mit Peter über die Brücke in die heutige Innenstadt gehe, deute ich auf das Spital, in dem meine Tochter zur Welt gekommen ist, gleich gegenüber vom Museum, aus dem Zimmer im dritten Stock, wo sie ihre ersten Atemzüge getan hat, streift der Blick über das Museum, die Bäume, die Hochhäuser im Hintergrund und die Lücke, die der Abriß des alten Baseballstadions vor einigen Jahren hinterlassen hat. Ich erwähne den Geburtsort meiner Tochter bei solchen Gelegenheiten gern, weil er mich an einen der stärksten Freudenmomente meines Lebens erinnert. Peter schaut hinüber, nickt, und wir gehen weiter, so soll es sein. Kleine Gesten, kurze Blicke. Wo Tod war, soll Leben sein.