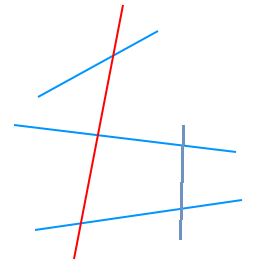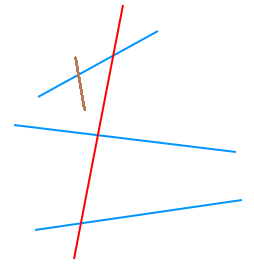Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Sowohl als Leser wie auch als Schreiber glaube ich bei bestimmten Texten etwas wie Dringlichkeit zu spüren. Seltsamerweise oft bei älteren Texten, und beim Schreiben sozusagen: immer seltener. In der gegenwärtigen Literatur finde ich solche Dringlichkeit kaum. Auch und gerade dann, wenn sich Autoren um möglichst aktuelle Themen bemühen, entsteht der Eindruck von Dringlichkeit nicht, statt dessen ein anderer, nämlich daß sie ein selbst auferlegtes Programm erfüllen, eine Pflicht erledigen. Viele wollen die Bedrohung der Umwelt in den Texten »unterbringen«. In den Erzählungen wird es immer heißer, dort und da brechen Brände aus, aber die Sätze brennen nicht unter den Nägeln.
Warum? Literatur – soll ich sagen: echte Literatur? – ist inaktuell, manchmal sogar antiaktuell. Jene Dringlichkeit, die ich meine, ist zum Beispiel bei Annie Ernaux zu spüren, die sich, jedenfalls in ihren literarischen Texten (was sie über Palästina denkt, hat damit wenig zu tun), nicht um aktuelle Themen kümmert. Ernsthaftigkeit ist ein verwandter Begriff, eine ähnliche Haltung. Ernsthaft kann heißen: durch den Schleier der Sprache zur Wirklichkeit durchdringen wollen. Dringlichkeit und Durchdringen. Weil Sprache, weil unsere Erzählungen, unsere Mythen, die allgemeinen wie die privaten, das Geschehene eher verdecken als enthüllen. Autoren wie Ernaux geht es um das Enthüllen: die Sprache so weit wie möglich zurückschrauben, interpretationslos schreiben, was war. Wahrscheinlich kann es da immer nur Annäherung zeigen. Bei Ernaux besteht das Erzählen im Mitschreiben dieser Annäherung.
Ernsthaftigkeit ist aber nicht alles, sie hat einen ehrenwerten Opponenten: die Verspieltheit. »Verspieltheit« klingt abwertend, ist aber nicht so gemeint. Spielerische Erzählliteratur, und nicht nur sprachspielerische, sondern mit Erzählelementen und Bildern spielende, trägt ihre raison d’être in sich, sie ist Selbstzweck, man muß sie nicht rechtfertigen. Kunst ist ihrer Genese nach eine Form des Spiels, ohne das menschliche Entwicklung nicht möglich ist. Wer Künstler wird oder bleibt, ist bloß mehr Kind geblieben als andere Erwachsene. Dieses spielerische Moment enthalten auch zahllose ernsthafte Erzählungen, etwa die von Peter Stephan Jungk, wobei ich an den autobiographisch-surrealen Roman Die Reise über den Hudson ebenso denke wie an das literarisch-ethnographische Kunstwerk Marktgeflüster. In der österreichischen Literatur gibt es eine besonders stark ausgeprägte Neigung zum spielerischen und verspielten Schreiben: Nestroy, Herzmanovsky-Orlando, die Wiener Gruppe, Ernst Jandl, Franzobel, Helena Adler – um hier nur anzudeuten, was und wen ich im Blick habe. Auch Friederike Mayröcker. Surrealismus bringt die Ordnungen und Ebenen durcheinander und baut neue Ordnungen auf, die wir nicht immer sofort nachvollziehen können oder wollen. Dann lassen wir uns vom Chaos streicheln. Das nenne ich »Spiel«. »Chaosmos«, der von Deleuze geprägte, jedoch von James Joyce geklaute Begriff gefällt mir immer noch, obwohl der Philosoph mittlerweile recht inaktuell geworden ist. Zeit, ihn wieder zu lesen. Chaosmos: die Welt im Zustand ihrer Entstehung.