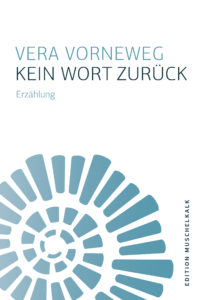
Kein Wort zurück
Ich kenne Vera Vorneweg seit Sommer 2018. Eines Tages fand ich eine Ausgabe der (inzwischen eingestellten) Literaturzeitschrift »Text+Bild« in meinem Briefkasten. Ein positive Folge der Impressumpflicht. Wir wohnten damals nur ein paar Straßenzüge auseinander und trafen uns fortan zwei, drei Mal im Jahr im »Schweidnitzer Eck«, sprachen über Literatur und Lektüren, über Peter Handke, Esther Kinsky, Karl Ove Knausgård, Gerhard Rühm oder Eva-Maria Alves, und andere.
Im Herbst 2018 erhielt Vorneweg ein Stipendium des Landes Thüringen und lebte einige Monate in der Ortschaft Kaltenlengsfeld. Ihre Eindrücke und Gedanken während des Aufenthalts hatte sie von ihrem Notizbuch in den Computer übertragen, dann ausgedruckt und an bestimmten Stellen im Ort angebracht, wie beispielsweise an einer Bushaltestelle. Literatur wurde somit öffentlich. Vorneweg betonte in den unvermeidlichen Stellungnahmen den Medien gegenüber, dass dieses Dorf sie zur Schriftstellerin gemacht habe.
»Ein ganz besonderes Buch« sollte aufgrund dieses Aufenthalts entstehen, so hieß es in einer Lokalzeitung. Man kennt das: Ausgezeichnete sind angehalten, das neue Umfeld in ihre Texte einfließen zu lassen. Dabei gibt es Texte über Großstadtmenschen in Dörfern und/oder in anderen regionalen Umgebungen zur Genüge. Sie drohen häufig in falsche Idyllik abzugleiten, oder, noch schlimmer, sich in gönnerhafte Arroganz zu verzetteln. Nebenbei stellt sich das Dilemma, dass sich Ortspersönlichkeiten ungeachtet ihrer Verfremdungen im Text womöglich falsch (oder richtig) getroffen fühlen. Es ist nicht einfach.
Bei einem erneuten Besuch in Thüringen 2019 geriet Vorneweg in den Landtagswahlkampf. Sie war empört über Aussagen auf den Plakaten der AfD, die sie unmöglich bei der Ein- oder Durchfahrt ignorieren konnte. Aber es schien, als habe sie ihr Thema gefunden. Sie berichtete mir über das Schreiben an einer Erzählung, die, wie sie sagte, nur zum Teil mit ihren Erfahrungen im Dorf zu tun habe, aber eine Notwendigkeit für sie sei.
Der Text selber blieb mir verborgen. Ich begrüßte das, obwohl meine Neugier mit jeder Erörterung stieg. Leider gab es Schwierigkeiten für den Text einen adäquaten Verlag zu finden, was sich aufgrund der Corona-Pandemie noch verschärfte. Zwischenzeitlich widmete sich Vorneweg der Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Literatur in Düsseldorf. Auch hier half ein Stipendium. Auf einer Rollade (neue Schreibweise eigentlich »Rolllade«) einer verlassenen Gastwirtschaft in Düsseldorf Oberbilk schrieb sie Eindrücke auf, die beim Schauen und Hören von der Straße und der unmittelbaren Umgebung des Hauses entstanden. Der Besitzer der Lokalität hatte ihr diese Nutzung gestattet. Erst wenn das Haus renoviert wird, verschwinden auch die Rolläden mit den Texten. Vergängliche Kunst. Immerhin: Ihre Impressionen sind hier auch darüber hinaus festgehalten.

