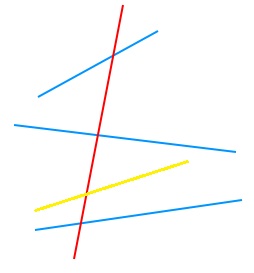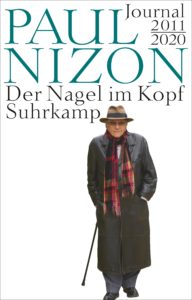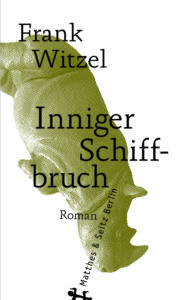Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Langsame Heimkehr wiedergelesen, den Roman, der sich Erzählung nennt. Natürlich erzählt da einer etwas, das ist unbestritten, und ob es dann zum Roman wird . . . ist letztlich egal. En fin du compte. Am Ende des Tages, wie die derzeit modische Floskel lautet: Die Mediensprache und damit die Gemeinsprache, denn alle sind mediatisiert, werden immer floskelhafter, rhetorischer, Freundschafts- und Following-Algorithmen tragen viel dazu bei, auch Emojis, im vergangenen Jahrhundert hätte ich mir nicht träumen lassen, daß die Rhetorik so massiv wiederkehrt (und ich meine nicht NLP, neurolinguistics for politicians, das ist wieder ein anderes Kapitel).
Egal. Enfin. Langsame Heimkehr, egal welchem der vier Teile, kann ich mich nicht nähern, ohne an die 1982 gesehene Aufführung von Über die Dörfer, dem ich glaube, dritten Teil der Tetralogie (oder war es der zweite?) in der Salzburger Felsenreitschule zu denken, die in mein literarisches wie auch bildliches Gedächtnis eingegangen ist. Regie Wim Wenders, auf der Bühne Martin Schwab, Libgart Schwarz, Handkes Ex, in der Rolle der Nova, der Heilsverkünderin, beeindruckend ernsthaft. Ich war damals für sowas empfänglich. Das allgemeine Publikum verschmähte Handke, den ehemaligen Pop-Star, der Zeitgeist fand das alles zu pathetisch. Das gab mir die Möglichkeit, für wenig Geld die Aufführung gleich noch einmal zu sehen.
Nova spricht da von der Mauer herab einen heideggerianisch-nietzscheanischen Aphorismencocktail, der schießt genauso ins Hirn wie die Karawanenmusik, die Wenders ausgewählt hat. Achtung, Kitschverdacht! Schon für den Roman (oder einfach: vor dem Roman), das erste Stück der Langsame-Heimkehr-Tetralogie, hatte Handke Heidegger gelesen. Ist man einmal von der Sprache des Philosophen affiziert, geht das nicht so schnell ab, und wie soll man ein Buch wie Sein und Zeit lesen, ohne für die Emotion empfänglich zu sein, das heißt, ohne sich zu öffnen? Langsame Heimkehr, der Roman, ist schon ein bißchen heideggerianisch. Und nicht nur deshalb schwer zu lesen. Besonders am Anfang, aber eigentlich über mehr als die Hälfte des Buchs hinweg, bis es endlich Schwung aufnimmt, ist die Syntax komplex, ihre bildhaft-bedeutungsschwere Belastung groß, so daß der Leser gezwungen ist, viele Sätze zweimal und öfter zu lesen.