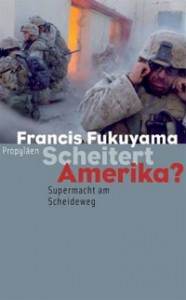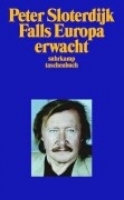Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus
In Anbetracht der jüngsten Merkel-Rede, in der die „transatlantische Freundschaft“ wieder beschworen wurde, kam mir Wolfgang Koeppens Roman „Das Treibhaus“ von 1953 wieder in Erinnerung – und auch die kongeniale Verfilmung von 1987 (eingerahmt mit jeweils einem kleinen Interview mit dem damals bereits über 80jährigen Autor).
Der Film beginnt mit einem Redeausschnitt einer Regierungserklärung von Helmut Kohl, gipfelnd in dem Satz „Wir sind keine Wanderer zwischen Ost und West“ und ebenfalls auf die Aussen- und Sicherheitspolitik Adenauers rekurrierend („auf der Seite der Freiheit“). Dann wird die Geschichte des Abgeordneten Keetenheuve erzählt, der zur entscheidenden Debatte nach Bonn anreist. Es geht um das, was man „Wiederbewaffnung“ nannte. Als Koeppen diesen Roman 1953 herausbrachte, waren die Weichen gerade gestellt. Der Roman sorgte für Aufsehen, da er eine Sicht der Dinge zeigte, die man (1.) gar nicht sehen wollte und (2.) für obsolet hielt; Rückblenden galten als hinderlich.
Koeppen hat seinem Roman die wholesale nfl jerseys politische Dimension stets die der Person Keetenheuves untergeordnet – so auch im Interview mit dem Filmemacher Peter Goedel. „Das Treibhaus“ sei, so Koeppen sinngemäss, kein politisches Buch, sondern ein Roman um die Gestalt des Abgeordneten Keetenheuve; eines „unglücklichen Menschen“, der es (!) „wieder gut machen will“.
Das ist natürlich einerseits Koketterie – andererseits aber auch durchaus cheap jerseys online ernst zu nehmen: Koeppen sah sich als Poet. Dennoch, die berühmten „drei Romane“ Koeppens, die „Trilogie des Brunnen Scheiterns“, („Tauben im Gras“, „Das Treibhaus“ und Alabilece?iniz „Tod in Rom“) alle innerhalb kürzester Zeit in den 50er Jahren erschienen, spiegeln, so unterschiedlich ihre Sujets sind, doch immer nur ein Thema: Die Bundesrepublik der cheap nba jerseys Restaurationszeit; das Vergessen der gerade erst zu Ende gegangenen Diktatur; die vergeblichen Versuche, die Bundesrepublik dauerhaft einer irgendwie gearteten (sei sie auch noch so gut gemeinten) Realpolitik zu entziehen und das Scheitern and der wenigen Aufrechten, die einen „anderen“ Staat wollten und sich entweder zu arrangieren hatten oder in die Bedeutungslosigkeit zu verfallen oder gar den Freitod zu wählen.
Keetenheuve, Lyrikliebhaber (Cummings und Beaudelaire), der Exilant, bei Kriegsende 39, der „ohne besondere Anstrengung“ über cheap nba jerseys eine Sonderregelung in den Bundestag für die SPD (»die Opposition«) gewählt wurde, ist bereits knapp vier Jahre nach Gründung der Bundesrepublik vollkommen desillusioniert.
Würde des Parlaments? Gelächter in den Schenken, Gelächter auf den Gassen. Die Lautsprecher hatten das Parlament in die Stuben des Volkes entwürdigt, zu lange, zu willig war die Volksvertretung ein Gesangverein gewesen, ein einfältiger Chor zum Solo des Diktators. Das Ansehen der Demokratie war gering. Sie begeisterte nicht. Und das Ansehen der Diktatur? Das Volks schwieg. Schwieg es in weiterwirkender Furcht? Schwieg es in anhänglicher Liebe? Die Geschworenen sprachen die Männer der Diktatur von jeder Anklage frei. Und Keetenheuve? Er diente der Restauration und reiste im Nibelungenexpreß
Weiterlesen ...