Eines vorweg: Der deutsche Titel von „America at the crossroads“ ist wieder einmal Beleg für den unnötigen und primitiven Alarmismus, mit dem Verleger glauben, höhere Verkaufszahlen erzielen zu können. „Amerika am Scheideweg“ reicht nicht, es muss heissen: Scheitert Amerika? – Supermacht am Scheideweg.
Auch die Erwartung, die vom Verlag geschürt und gelegentlich von Rezensenten übernommen wurde, nämlich eine „Abrechnung“ des (ehemaligen) „Neocon“ (Neokonservativen) Francis Fukuyama, Professor der Politikwissenschaften, mit der Administration Bush, bleibt aus. Im grossen und ganzen kritisiert der Autor nur einen bestimmten Auswuchs einer von ihm im Kern durchaus richtig empfundenen Politik; da helfen auch alle Distanzierungen (auch in Interviews) nicht; an den Kernthesen des Neokonservatismus rüttelt er nicht.
Im Verlauf des Buches scheint sich seine Kritik immer mehr auf den Irakkrieg der Bush-Administration zu fokussieren (und zu monopolisieren), wobei er selbst diesen noch fast unfallhaft darstellt und den Spiess irgendwann schlichtweg umdreht: Die Krise des kollektiven Handelns der internationalen Staatengemeinschaft wurde nicht, wie viele annahmen, von der Bush-Regierung verursacht, sondern von den Vereinten Nationen und jenen Europäern, die im Rahmen der UNO Sicherheit gewähren wollten.
Solche Sätze gibt es sehr viele in diesem Buch. Fukuyama lässt in all seinen Betrachtungen keinen Zweifel daran, dass er grundlegenden Thesen des aktuellen Neokonservatismus der USA immer noch zugeneigt ist. Sein Buch kann als Versuch gewertet werden, diese Bewegung in eine bestimmte Richtung zu führen.
Im ersten Viertel des Buches gibt der Autor einen Abriss der historischen Entwicklung der neokonservativen Bewegung. Diese sei, so Fukuyama, zunächst aus einer antikommunistischen, antimarxistischen, aber auch antiliberalen, antilibertären (!) Linken der 30er und 40er Jahre hervorgegangen. Ihre Keimzelle sieht er im City College New York (CCNY); sehr häufig waren es Söhne jüdischer Einwanderer. Es folgt ein ausführlicher Exkurs über die historischen Entwicklungen und Verzweigungen, die vor allem eines zeigen: Neokonservatismus war (und ist) nie eine stringente Weltanschauung gewesen. Ein Teil seiner Anhänger wandte sich irgendwann dem rechten Antikommunismus der McCarthy-Ära zu; ein anderer Teil wiederum wurde eine eher gemässigter Republikaner oder ein eher „rechter“ Demokrat. Einigkeit herrschte am ehesten noch in einer Ablehnung eines irgendwie gearteten Werterelativismus (und natürlich Zustimmung für eine Position des frenetischen und unnachgiebigen Antikommunismus).
Fukuyama bestreitet heftig einen bestimmenden Einfluss von Leo Strauss auf die weitere intellektuelle Zurüstung der Bewegung; gar ein direktes Hinführen des Denkens von Strauss zum Irakkrieg der Bush-Regierung. Als Kronzeugen zieht Fukuyama Mark Lilla heran, der Strauss als einen Essayisten vormoderner, europäischer Denker sieht und nicht als den Lehrer einer politischen Bewegung. Die Affinität, die Strauss’ Denken zum „Freund-Feind-Denken“ des Staatsrechtsphilosophen Carl Schmitt entwickelt, unterschlägt Fukuyama. (Es gibt mehrere solcher „Unterschlagungen“ im Buch, die nicht nur ärgerlich sind, da ich damit automatisch den Inhalt der anderen Teile auch relativieren muss – „Was verschweigt der Autor hier vielleicht?“.)
Die Beschreibung der Verzweigungen der neokonservativen Bewegungen mag für Insider interessant sein, sagt aber dem Europäer, der diese Personen nicht zuordnen kann, wenig. Interessant wird es wieder, wenn Fukuyama auf die Zeit ab den 70er Jahren rekurriert. Neokonservative Kräfte stellen sich dezidiert gegen „Realisten“ (wichtigster Protagonist war hier Henry Kissinger; die Wahl des Demokraten Jimmy Carter zum Präsidenten war ein Alptraum für konservative Kreise aller Art), die eine Aussenpolitik betrieben, die die damalige UdSSR als feste Grösse der Weltpolitik akzeptierten und auch über Verhandlungen versuchten, Annäherungen in strittigen Fragen zu erreichen (während parallel versucht wurde, der „Dominotheorie“ durch Implementierung freundlich gesonnener Diktatoren in Schlüsselstaaten entgegenzuwirken). Gleichzeitig wurde neokonservatives Ideengut in andere, „traditonelle“ Denkmodelle beispielsweise der Republikaner übernommen.
Auf anderen Gebieten – Ökonomie, Gesellschaft, gar Ökologie – hatten Neokonservative keine dezidierten Konzepte vorzuweisen. Ihr Gebiet erschöpfte sich fast ausschliesslich in aussen- und geopolitischen Fragen. Grosse Teile der neokonservativen Denker hatten sogar ihren Frieden mit dem Marktkapitalismus geschlossen; später wurden sie sogar teilweise glühende Anhänger.
Natürlich setzt sich Fukuyama mit der Reagan-Ära auseinander. Er hält Reagan (im Gegensatz zu George W. Bush) für einen waschechten Neokonservativen; der erste, der es ins Präsidentenamt schaffte. Ein bisschen abenteuerlich scheint mir seine These, Reagan sei ein Intellektueller gewesen, der sehr früh gegen Kommunisten oder deren Sympathisanten in Hollywood Stellung bezogen habe und in seiner weiteren politischen Laufbahn hierdurch geprägt worden sei.
Reagans Antikommunismus, sein Wort an Gorbatschow die Mauer niederzureissen, seine Rede vom „Reich des Bösen“, das Projekt eines Weltraumschutzschildes, die dramatische Aufrüstung des amerikanischen Militärs – all das sieht Fukuyama nicht als Auswüchse eines eher tollpatschigen und undiplomatisch agierenden, schlechten Schauspielers, sondern als Produkt einer stringenten, auf die „Freiheit“ und „Demokratie“ anderer Länder ausgerichteten Politik. Wieder wird Essentielles verschwiegen – hier Reagans wahnwitzige aussenpolitische Stellvertreterkriege (insbesondere in Süd- und Mittelamerika; die entsprechenden Konflikte werden sehr viel später in anderem Zusammenhang mit den jeweiligen Ländernamen angedeutet), die tatsächlich einem fast manisch-krankhaften Antikommunismus geschuldet sein dürften, aber den Keim für noch heute andauernde soziale und ökonomische Probleme in den entsprechenden Ländern legte.
Am Ende des Kapitels arbeitet Fukuyama vier Grundprinzipien heraus, die von der grossen Mehrzahl der Neokonservativen vertreten werden:
- Die Überzeugung, dass der innenpolitische Charakter eines Regimes sich auch auf dessen Aussenpolitik auswirkt und dass sich in der Aussenpolitik die tiefsten liberalen Werte demokratischer Gesellschaften ausdrücken müssen. Die Auffassung, dass der Charakter eines Regimes auch dessen Aussenpolitik bestimme, wurde von den Neokonservativen konsequenter vertreten als die alternative realistische Auffassung, dass alle Staaten ungeachtet ihrer Regierungsform gleichermassen nach Macht streben. [...]
- Die Überzeugung, dass die amerikanische Macht zu moralischen Zwecken eingesetzt wurde und werden sollte und dass die Vereinigten Staaten sich auch weiterhin in internationalen Angelegenheiten engagieren müssen. [...]
- Ein Misstrauen gegenüber Projekten einer Sozialtechnologie in grossem Massstab. [...]
- Schliesslich eine skeptische Haltung gegenüber der Legitimität und Effektivität des Völkerrechts und internationaler Institutionen zur Verwirklichung von Sicherheit oder Gerechtigkeit. [...]
Der weitere Fortgang des Buches weist Fukuyama deutlich – wie bereits erwähnt – als neokonservativen Denker aus. Seine Reserviertheit entspringt ausschliesslich der Politik Bushs seit dem 11. September 2001 und speziell dem unilateralen (Quasi-)Alleingang im Irakkrieg 2003; ein bisschen wohl auch der Person George W. Bush, den er in einem der seltenen pointierten Formulierungen in diesem Buch indirekt als schlechten politischen Führer bezeichnet.
Fukuyama weist im eindrücklichsten Kapitel des Buches nach, dass die Administration Bush die Gefahren des islamistischen Dschihadismus nach den Anschlägen vollkommen übertrieben dargestellt hat und noch immer darstellt.
Die Gefahr für die Vereinigten Staaten einer Wiederholung einer Al-Qaida Attacke ähnlichen Ausmasses schätzt er (wohl begründet) als sehr gering ein. Letztlich sieht er eher Europa und die unmittelbar betroffenen Regionen des Mittleren Ostens als Ziele. Luzide und sehr interessant seine These, die „gefährlichen“ Dschihadisten seien in der Mehrzahl nicht in die westliche Gesellschaftordnung Europas integrierte Einwanderersöhne der 2. oder 3. Generation. Nicht fehlende demokratische Strukturen in den Heimatländern sei der Grund für den weltweiten Terrorismus. Fukuyama verweist das Problem an die europäischen Sozialpolitiker und belegt dies mit den Lebensläufen der Attentäter des 11. September, die fast alle gut ausgebildet, aber nicht sozial integriert und akzeptiert gewesen seien und daraufhin mit der Zeit ihren Hass auf die westliche Ordnung gebildet hätten.
Als zweiten, gravierenderen, Grund gegen den Irakkrieg führt Fukuyama die These an, dass eine Demokratisierungskampagne nie ohne entsprechende Unterstützung und entsprechende Infrastruktur im jeweiligen Land erfolgreich sein kann. Er bedient sich neokonservativer Thesen, um nachzuweisen, dass die Regierung Bush falsch gehandelt hat:
Bevor es eine Demokratie geben kann, braucht man einen Staat: die Schaffung und Stärkung staatlicher Institutionen in Konfliktregionen, kurz: State-Building, ist eine Aktivität, die sich nur partiell mit Demokratieverbreitung überschneidet.
Fukuyama schliesst sich Huntingtons These an, dass die Entwicklung einer starken politischen Autorität für eine wirtschaftliche Entwicklung notwendig sei und einer demokratischen Regierungsform vorausgehen müsste.
Diese „vordemokratische“ Regierung kann jedoch nicht ohne Zustimmung der intellektuellen, religiösen und sozialen Eliten eines Staates implementiert werden und schon gar nicht durch eine Besatzungsarmee oder ein Regime, welches von der Gnade der jeweiligen Besatzer abhängig ist, eingerichtet werden. Daher existiere, so Fukuyama, ein grundlegender Unterschied zwischen Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg und dem aktuellen Irak.
Die Bush-Administration habe den Fehler gemacht, über die Beseitigung des Diktators nicht hinaus gedacht zu haben. Hier macht Fukuyama insbesondere Verteidigungsminister Rumsfeld verantwortlich, der aus egoistischen Gründen das Kontingent an Soldaten so gering wie möglich halten wollte und im Vorfeld keinerlei Experten zur Implementierung einer für alle Seiten akzeptablen Nachkriegsordnung zugezogen hat.
Wenn Fukuyama dann später beklagt, dass die USA 1991 bei der Befreiung Kuwaits Saddam Hussein in Bagdad hätten „entwaffnen“ sollen (obwohl dies nicht durch die Resolutionen des Weltsicherheitsrats gedeckt gewesen wäre), so widerspricht er sich selber: Auch damals hätte eine Besatzung oder Kolonialisierung des Irak zu ähnlichen Effekten geführt wie heute, da die entsprechende „Lage“ nicht „aufbereitet“ gewesen wäre.
Bei aller Kritik auch an den Thesen neokonservativer Politiker der 90er Jahre, die Welt bedürfe einer benevolent hegemony, also einer wohlmeinenden und gütigen Hegemonie, so vernichtend fällt Fukuyamas Urteil über die Vereinten Nationen aus, denen er jegliche Legitimation abspricht und die Institutionen (insbesondere den Weltsicherheitsrat) für vollkommen uneffizient hält.
Wer wissen will, wie die Bush-Regierung hier denkt, ist mit den entsprechenden Kapiteln dieses Buches sehr gut bedient. Fukuyama spricht der UNO nicht nur jegliche Legitimation ab (einer der Gründe ist, dass etliche Länder der UNO angehören, die nicht demokratisch regiert werden und die häufige Patt-Situation des Weltsicherheitsrates, in dem ein Veto eines ständigen Mitgliedes ausreicht, eine Resolution zu blockieren), sondern auch jegliche Reformfähigkeit. In Bausch und Bogen – und ohne auch nur mit einem Wort Reformvorschläge auszubreiten – landet die Organisation bei Fukuyama in den Orkus der Geschichte.
Nur mühsam verbirgt der Autor die wahren Gründe: Die USA können durch die spezielle Konstellation des Weltsicherheitsrates keine Machtpolitik betreiben, in der sie das letzte Wort haben. Das ist aber exakt das, was Fukuyama als „effizient“ bezeichnet. Stillschweigend übernimmt er die These des US-amerikanischen Exzeptionalismus (führt ihn auf George Washington zurück) und möchte ihn – in abgeschwächter Form als heute von der Bush-Regierung bereits umgesetzt – dennoch als Ultima ratio behalten, wie es in der NSS vorgezeichnet ist: Man könne darauf vertrauen, dass sie [die USA] von ihrer militärischen Macht in einer gerechter und vernünftigen Art und Weise Gebrauch machten, wie es anderen grossen Staaten nicht möglich sei.
Dass die USA durch ihre eigene Politik selbst an einer Ineffizienz der UNO eine Mitschuld tragen, erwähnt Fukuyama nur am Rande und entschuldigt es wiederum als notwendige Bündnismassnahme. In dem er jedoch die Legitimation der Vereinten Nationen zur Durchsetzung des Völkerrechts ablehnt und die Organisation nur als exekutives Ausführungsorgan friedenerhaltender Missionen sieht, sägt er am Ast, der ihn selbst trägt: Nur einmal stellt er sich die Frage, was wäre, wenn eine andere Macht auf der Welt wie im Irakkrieg mit derart falschen Begründungen einen souveränen Staat besetzt hätte. Wie hätten die USA wohl reagiert? Fukuyama verfolgt den Gedanken nicht weiter – vermutlich denkt er, dass dies (wenigstens derzeit) keine Nation wagen würde, da sie mit der Reaktion (auch militärischer Art) der USA zu rechnen habe.
Wenn die UNO nun abgelehnt wird – was setzt er dagegen? Nun, um es vorweg zu nehmen – hier wird Fukuyama sehr schmallippig; spricht von multi-multilateralen Organisationen und Institutionen (als Beispiel nennt er u. a. die ICANN). Mal plädiert für einen losen Bund multilateraler Organisationen (insbesondere die NATO ist ihm sehr recht; wenngleich er auch die Fadenscheinigkeit amerikanischer Politik der NATO gegenüber anlässlich des Irakkrieg geisselt), mal schwebt ihm eine Art Gemeinschaft demokratischer Staaten vor; auch eine Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, die sich für die »richtigen« Ziele einsetzen, kommt für ihn infrage. Konkret wird er nicht. Stattdessen bietet er folgende Graphik an:
In seiner Bündnispolitik, die sich mit verschiedensten Organisationen und Institutionen bestimmte Interessenclaims absteckt, erinnert er an Bismarck – und tatsächlich am Ende des Buches hebt er die Bündnispolitik des Reichskanzlers als beispielhaft und richtungweisend heraus. Den Zusammenbruch, der in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs mündete, lastet Fukuyama den Nachfolgern an, die die Genialität Bismarcks nicht hätten nachvollziehen können.
Warum er jedoch bei allem „UNO-Bashing“ ausgerechnet das einzige Exempel in der jüngeren Geschichte, in dem der von ihm so erwünschte „realistische Wilsonianismus“ (benannt nach dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson [1856–1914], der vehement für einen demokatischen Internationalismus im Rahmen einer Organisation wie beispielsweise des Völkerbunds [Vorläufer der UNO] eintrat) wenigstens ansatzweise versucht und auch durchgezogen wurde, verschweigt, ist nur dahingehend zu verstehen, wenn man Fukuyama unterstellt, dass dies schlichtweg nicht in sein Konzept der uneffizienten UNO passt.
Als nämlich Saddam Hussein 1990 Kuwait überfiel, schmiedete der damalige US-Präsident George H. W. Bush eine grosse, weltweite Koalition, u. a. auch Länder wie Syrien oder Saudi-Arabien umfassend, die institutionell über die Organe der Vereinten Nationen bis zum Weltsicherheitsrat hinein eine militärische Aktion im Falle des Scheiterns von Verhandlungen vorsah, um im angegriffenen und besetzten Land wieder den Status quo herzustellen.
Man muss die propagandistischen Lügen, die im Vorfeld zur Präparierung der Koalition und Interventionsstimmung in den entsprechenden Ländern geführt haben, verurteilen und auch das nepotistische Regime von Kuwait als nicht besonders unterstützenswert erachten und in einer der Folgen dieser Koalition (die Verwendung Saudi-Arabiens als Stützpunkt des US-Militärs) den aktuellen Dschihadismus sehen – diese Einschränkungen, die den konkreten Fall durchaus als zwielichtige Massnahme erscheinen lassen, sollen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mindestens in diesem Fall die Institutionen der UNO durchaus „funktionierten“. Die von Fukuyama so plakative Verdammung der Vereinten Nationen ist eben nicht ein zwingendes Naturgesetz und seine Schlussfolgerung, einer einzigen, globalen Institution zu folgen, bedeute ein sicheres Mittel entweder für eine Tyrannei, falls diese Institutionen tatsächlich bestimmte Machtbefugnisse hätte, oder für Ineffizienz, wie wir sie seit langem von der gegenwärtigen UNO kennen ist in dieser Dichtomie intellektuell nicht haltbar.
Man darf als Leser durchaus erwarten, dieses Faktum nicht vorenthalten zu bekommen, sondern hätte sich hier eine entsprechende Berücksichtigung gewünscht.
Überhaupt verlässt Fukuyama sehr oft die vorurteilsfreie, neutrale Sichtweise des Analysten. Zu sehr scheint er in sein Denkmodell verhaftet zu sein. Das führt zu oftmals abenteuerlichen Verallgemeinerungen – insbesondere, wenn es um ausseramerikanische Belange geht.
So sieht er den Kommunismus aufgrund innerer moralischer Schwächen als gescheitert – die entscheidenden, ökonomischen Aspekte spielen keine Rolle bei ihm. Die Abrüstungsverhandlungen der 70er und 80er Jahre mit der UdSSR sieht er als eher stabilisierend für den damaligen Warschauer Pakt und die entsprechenden Regime.
Seine Sicht auf Afrika ist kolonialistisch – gelegentlich verzettelt er sich in Widersprüche, wenn er einerseits den Nationalstaat als alternativlos darstellt, andererseits jedoch (insbesondere in Schwarzafrika) zugeben muss, dass dieses „Modell“ nicht annäherend zur gleichen politischen Stabilität wie beispielsweise in Europa geführt hat.
Die NATO setzt Fukuyama flugs als alternativen Gegenentwurf zur EU und deren Verfassungsentwurf. Das „Nein“ Frankreichs und den Niederlanden eröffnet für ihn neue Möglichkeiten für eine Verstärkung der Rolle der NATO. Es mag einem angst und bange werden anlässlich dieses geostrategischen Minimalismus. Zumal Fukuyama selbst die Ineffizienz des Einstimmigkeitsprinzips der NATO einräumt und auch hier keine Probleme mit einer Vormachtstellung der USA hat [nebenbei erwähnt, hätte es einem Lektor auffallen müssen, daa nicht die Bush-Regierung im Kosovo-Krieg ein unilaterales Vorgehen aussprach, sondern die Clinton-Administration verantwortlich zeichnete]. Nebenbei vergisst Fukuyama plötzlich den besonderen Status von Frankreich in der NATO. Die Ablehnung des EU-Verfassungsentwurfs in diesen beiden Ländern hatte ganz sicher andere Gründe, als die von Fukuyama gedachten.
Seine emphatische Rede von der kulturunabhängigen Anziehungskraft der Demokratie gilt merkwürdigerweise immer nur dann, wenn die entsprechende Regierung dem machtpolitischen Spiel der USA dienlich ist.
Geradezu geschichtsklitternd wirkt Fukuyamas Sicht auf die Aussenpolitik der USA nach dem Zusammenbruch 1989/90: Sie hätten wesentlich zur Beseitigung von Diktaturen (beispielsweise in Chile oder Nicaragua) beigetragen und Demokratie in vielen Ländern ermöglicht. Leider »vergisst« er, dass diese Schurken Jahrzehnte vorher erst durch direkte oder indirekte Einmischungen etabliert wurden.
Und auch kein Wort von der aktuellen Gemengelage der US-Aussenpolitik beispielsweise in Zentralasien und die Unterstützung der dortigen Diktaturen, sofern sie nur im »Kampf gegen den Terrorismus« dienlich sind. Mit exakt der gleichen Politik wie im Kalten Krieg – »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« – wird dort agiert. Die steht nicht nur in eklatantem Widerspruch zu den hehren Zielen des Neokonservatismus, sondern ist, das ist längst an unzähligen Beispielen belegbar, gescheitert.
Auch auf die Entwicklung von Ländern wie China oder Indien, die mittelfristig den USA das Grossmachtmonopol streitig machen werden, geht Fukuyama nicht ein. Für ihn scheint die Vormachtstellung der USA langfristig und dauerhaft. Hierin könnte sein grösster, sein entscheidender Irrtum liegen.
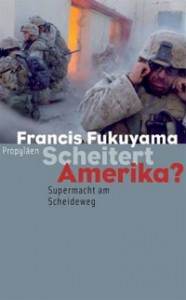
Danke
für diese ausführliche Rezension bzw. Darstellung.
Ich komme wieder zum gründlichen Lesen.
Wenn ich den Zusammenhang richtig verstanden habe, sucht F. nach einer taktischen Anpassung angesichts von Mißerfolgen vor allem im Irak. Daß man grübelt, ist bemerkenswert.
Die Grundlinien neokonservativer Politik will er nicht ändern, im Gegenteil, wie sich besonders an der Behandlung des Problems UNO zeigt. (Sehr interessant hier der Link auf den Artikel von Hinsch zu Exzeptionalismus.)
Seine Sichtweise, den islamischen Dschihadismus nicht zu überschätzen und die Wurzeln des Terrors in unbewältigter Integration nicht zuletzt in Europa zu suchen, finde ich interessant.
Er scheint aber nicht zu betrachten bzw. nicht zu verstehen, warum Bush und Co. zu dieser Hypostasierung greifen (müssen).
Und so scheint es, daß F. an den wirklichen tektonischen Kräfteschiebungen vorbei analysiert. Ganz Im Sinne des letzten Absatzes Deiner Rezension.
Taktische Anpassung
ist eine sehr schöne Formulierung und Beschreibung für das, wie ich es empfunden habe.
Das interessanteste Kapitel ist tatsächlich das über Europa und den Dschihadismus; es fällt ein wenig heraus, da er damit nur illustrieren möchte, dass die Hysterie der Bush-Administration (Krauthammer-Papier) überzogen ist. Auf die Idee, welchen zusätzlichen Aspekt man mit dem »Patriot Act« auch noch »abdeckt« (Überwachung der Bevölkerung), kommt er gar nicht.
Teilweise erschreckend fand ich seine manchmal fast naive Sicht auf europäische Politik.
Im übrigen gibt es eine sehr schöne Rezension von Claus Leggewie in der ZEIT (die ich mir zu lesen bis zum Ende meiner Besprechung verkniffen hatte). Er hält Fukuyama mehr oder weniger nur für ein Medienphänomen.
»Medienphänomen«
ist ein gutes Stichwort.
Nach Deiner Besprechung hab ich mich auch gefragt, was bleibt denn nun eigentlich als Substanz übrig...
Bismarck & NGO
Fukuyama lehnt den »wohlmeinenden Hegemon«, der interventionalistisch ohne Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten das Glück der Demokratie in die Welt hineinbomt zwar ab, lässt aber letztlich keinen Zweifel daran, dass die USA moralisch legitimiert, ja verpflichtet sind, derart tätig zu werden, wenn dies nur gewünscht wird.
Im Rahmen dessen schwebt ihm eine Art globaler Bismarckscher Bündnispolitik vor, eventuell assistiert von Nichtregierungsorganisationen, die von den jeweiligen Bündnispartnern dementsprechend legitimiert sind. Auch hier bleibt es allerdings für ihn klar, wer Koch und wer Kellner ist.
Was übrigbleibt? Schwierig zu sagen. Ein bisschen wirkt es manchmal, dass dort jemand zutiefst enttäuscht ist, dass man nicht auf ihn gehört hat... (aber das ist fast anmassend)