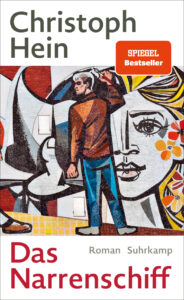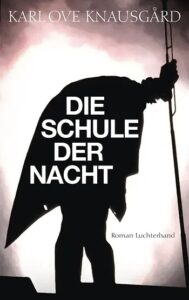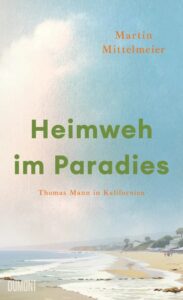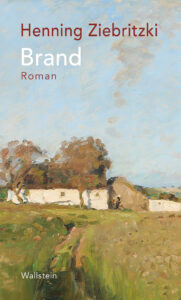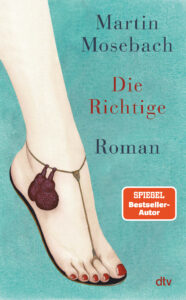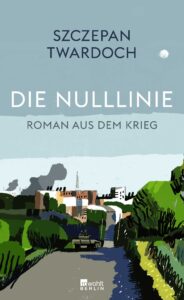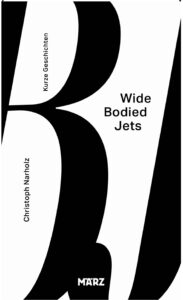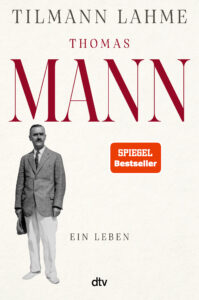
Man sucht nach einem Begriff, mit dem adäquat beschrieben werden kann, was das neueste Buch des Literaturwissenschaftlers und Golo-Mann-Biographen Tilmann Lahme mit dem harmlosen Titel Thomas Mann ausgelöst hat. Wäre »Erdbeben« vielleicht recht? Wenn ja, welche Stärke hat dieses Beben auf der nach oben offenen Feuilleton-Skala? Dabei mutet der auf dem Cover in kleinerer Schrift gedruckte Untertitel harmlos an: »Ein Leben« steht dort. Der Verlag greift in seiner Werbung eine Spur höher und textet »Thomas Mann und sein wirkliches Leben«. Enthüllungen werden angedroht. Wer derart auftrumpft, muss liefern. Und Lahme versucht das. Sein Buch ist keine Biographie, er wiederholt nicht auf Vollständigkeit zielend die längst bekannten Daten, Fakten, Episoden und Anekdoten, Lahme liefert auch nur eher sparsame Interpretationen von Thomas Manns Prosa – und dort, wo er es macht, wird es mindestens einmal peinlich, doch dazu später.
Lahme schreibt nicht über Thomas Manns Leben, sondern vor allem über Thomas Manns Sexualleben. Er betreibt das, was Dieter Borchmeyer nicht ganz abwegig »Biographismus« nennt. Und er stellt sich diesen Exegeten mit offenem Visier entgegen. Am Ende bilanziert Lahme, dass »die im literarischen Anspielungsraum verborgene gleichgeschlechtliche Liebe bei Thomas Mann als ein wesentliches Element seiner literarischen Kunst zu betrachten« sei. Nach der Lektüre vermittelt sich einem der Eindruck, es sei DAS wesentliche Element.
Dass Thomas Mann homosexuelle Neigungen hatte, die sich in heute eher als lächerlich zu betrachtenden Schwärmereien äußerten, ist natürlich kein Geheimnis mehr. Und das er unter der zeitgemäßen Notwendigkeit, diese zu verbergen gelitten hat, ist ebenso bekannt. Aber Lahme will mit seinen Recherchen zeigen, dass die Unterdrückung der Homosexualität mehr war als nur ein sich Arrangieren mit und in den Zwängen der Gesellschaft, sondern ein lebenslanger Kampf gegen die »Hunde im Souterrain« seines Wesens, wie er seinem Freund Otto Grautoff 1896, 21jährig, in Anlehnung an eine Formulierung von Friedrich Nietzsche schrieb.