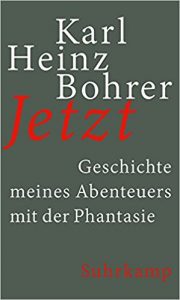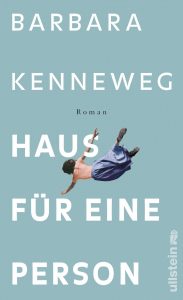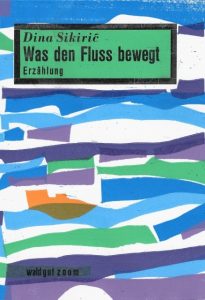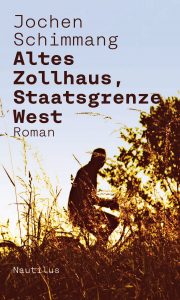
Altes Zollhaus, Staatsgrenze West
Zum ersten Mal erzählt Jochen Schimmang von Gregor Korff 2009 in »Das Beste, was wir hatten«. Er beginnt mit dem Silvestertag 1989 und Korff, damals 41, blickt wehmütig und gleichzeitig ein wenig stolz auf die vorhersehbar zu Ende gehende Bonner Republik zurück. Er, der eigentlich sozialliberale Geist, ist Ministerberater in der Regierung Kohl, und steht der kommenden Einheit und dem damit größer werdenden Deutschland skeptisch gegenüber. Die großen historischen Veränderungen der Bundesrepublik kontrastiert er mit seinem bisherigen Leben und konstatiert ein wenig überraschend, wie kleinste und zunächst unscheinbar daherkommende Begebenheiten sein Leben im Nachhinein entscheidend geprägt haben. Manchmal ähnelt Korff ein bisschen Koeppens Keetenheuve (jetzt Wiedervereinigung und damals, bei Koeppen, Wiederbewaffnung). Aber Korffs Melancholie verwandelt sich nicht in Depression. Und so entwickelt sich der Roman nach den 60 Seiten elegisch-epischer Reminiszenz immer mehr in Richtung Agentengeschichte, in der Korff in den nächsten vier Jahren seines Lebens (wenig überzeugend) seine Re-Anarchisierung versucht, nachdem er seine Beraterposition wegen einer Liebschaft zu einer Stasi-Agentin verliert.
2011 legte Schimmang mit »Neue Mitte« einen dystopischen Zukunftsroman über das Jahr 2029 vor. Er erzählt von einem in Ruinen liegenden Deutschland, das gerade eine Diktatur überwunden hat und sich neu orientiert. In einem der Erzählstränge sucht der Ich-Erzähler Ulrich Anders seinen vermutlichen Vater, einen gewissen Gregor Korff, der um 2018 herum in Paris gestorben sein soll. Das Grab existiert jedoch nicht mehr und alle Spuren führen ins Nichts.
Mit »Altes Zollhaus, Staatsgrenze West« geht es nun zurück in die Gegenwart der Jahre 2015/16. Korff erfreut sich bester Gesundheit und lebt im fiktiven Ort Granderath an der deutsch-niederländischen Grenze in einem von ihm renovierten ehemaligen Zollhaus. Finanziell ist er unabhängig, denn er lebt von den Einnahmen eines Thrillers über die Spionageaffäre, die ihn seinen Job gekostet hat. Er hatte dieses inzwischen natürlich auch verfilmte Buch zwar nicht geschrieben, aber der Autor, der inzwischen verstorben ist, wollte es nicht unter seinem Namen veröffentlichen. So ist Korff streng genommen ein Fake-Autor, obwohl die Geschichte nach seinen Erzählungen aufgeschrieben wurde.