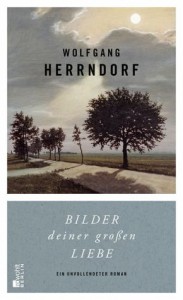TAGEBUCHEINTRAGUNGEN NOVEMBER 1988
9. November, Mittwoch, New York City – Um halb 2h bei Ronald1 im Büro. Er führt uns durch die Räume (auf dem selben Stockwerk: Estée Lauder Corporation) die voll sind mit moderner Kunst – Rainer, Brus, Beuys, Penck, etc., unglaubliche fin-de-siècle-Möbel, aber alles in Neonlicht getaucht. Seltsame Szene danach: eingepfercht in seinen unglaublich vollen Terminkalender nimmt er uns ins innerste Büro, serviert Pastrami-Sandwich, dazu Salzgurke und Cream Soda – und hält uns beiden eine 10-Minuten-Ansprache über unser Leben, ganz rabbinisch, unglaublich herzlich, wenn auch naiv -. Wir seien jetzt viel stärker aufeinander angewiesen, seitdem wir beschlossen hätten, zusammenzuziehen, aber Paris sei seiner Meinung nach nur ein »cop-out»2, nur eine Zwischenlösung, die eigentliche Stadt für uns sei natürlich New York, hier sollten wir uns niederlassen. Sage ihm, daß diese Variante am trivialen Geld-Problem scheitern würde – seine Überlegung, vollkommen richtig, dass ich eigentlich auf Englisch schreiben sollte. Daß meine Aufgabe im Grunde die wäre, eine Art Brücke zu bauen zwischen den Amerikanern und den deutschsprachigen Ländern Europas. Daß mein Werk der Versöhnung zwischen Juden und Deutschen dienen könnte, dienen sollte. L.3 und ich etwas erstaunt, aber durchaus positiv überrascht ad diesem väterlich-rabbinischen Ton – fühlen uns in Freundschaft geborgen. (...) Abends der große Lauder-Event im 92.Street Y, ein jüdisches Auditorium, gepackt voll, Leute vom Jüdischen Weltkongress, und Simon Wiesenthal, Elie Wiesel, Arthur Cohn, Bürgermeister Edward Koch, etc., alle versammelt. Recht gute Ansprachen – alle drücken Ronald ihre Hochachtung aus. Vorführung des Films4 ad Reichskristallnacht, der heute gleichzeitig via PBS im ganzen Land gezeigt wird.
Weiterlesen
Ronald Lauder, geboren 1944, Sohn der Kosmetik-Unternehmerin Estée Lauder (1906 – 2004); Unternehmer, Präsident des Museum of Modern Art, New York. Große Teile seiner Kunstsammlung sind seit 2001 in der von ihm gegründeten Neuen Galerie in New York untergebracht. Seit 2007 Präsident des Jüdischen Weltkongresses. Siehe hier ↩
Ausweichmanöver, Verlegenheitslösung ↩
Lillian Birnbaum, spätere Ehefrau des Autors. ↩
Anlässlich des 50. Jahrestages der "Reichskristallnacht" produzierte Lauder den Dokumentarfilm "Kristallnacht, the Journey From 1938 to 1988" ↩