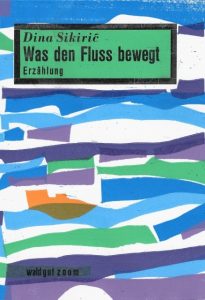Der Klingelbeutel war ein länglicher Beutel aus rotem Samt, mit einem goldenen Glöckchen an seinem unteren Ende, das sich wie eine Wurst zusammenzog. Er hing vom Ende einer langen hölzernen Stange und schaukelte ein wenig, wenn er sich durch die Kirchenbankreihen bis zur in der Mitte sitzenden, dort zusammegekauerten Person (das war ich) vorantastete, wobei es ein wenig hüpfte und das Glöckchen klingelte, wenn ich oder ein anderer der Aufforderung nicht nachkam, sei es, weil ich die Münze für einen anderen Zweck behalten wollte, sei es, weil er die Geldbörse vergessen hatte, sei es, weil er sich weigerte oder an diesem Sonntag keine Lust hatte, der Kirche den Obulus zu entrichten (so nannte, so erklärte es in der Schule der Pfarrer). Rot und Gold, die Farben des Königs, sein Reich ist von dieser Welt.
Der Mann, der den Klingelbeutel am anderen Ende der manchmal ins Endlose wachsenden Stange hielt, hatte einen weit über seine roten Backen hinaus gezwirbelten weißen Schnauzbart, und er schaute verschmitzt, wenn er am Werk war, oder mißmutig, wenn er auf ein Zögern, einen Widerstand stieß. Hatte er eine Seite bearbeitet, kam er von der anderen, und ich fürchtete, sein Gesicht würde zornig, weil er meine Geste vergessen hatte und eine zweite Münze erwartete (aber die Mutter hatte mir nur eine gegeben). Er war ein Pferdeknecht, dieses Wort hatte ich mehrmals gehört, auf einem abgelegenen Gut und war vorzeiten ein Kutscher gewesen, hatte sogar – aber nein, das war sein Urgroßvater gewesen, der hatte die Königin durchs Tal kutschiert, als die hintere Achse brach, doch die Königin blieb durch Gottes Gnade unverletzt, weshalb sie die Kapelle am Wegrand errichten ließ, die als einziges Bauwerk im ganzen Ort vom Zahn der Zeit verschont geblieben ist mit ihren weißen Wänden und dem blauen, luftig bewölkten Himmel über dem Kopf der Mutter Gottes.
Der Kutscher trug schwere Reitstiefel, die ein kratzendes Geräusch auf den Steinfliesen machten, wenn er mit seiner Beute abzog. Es waren ähnliche Stiefel wie jene, die ich vom Dachboden heruntergetragen hatte, als ich älter wurde und einen Sinn für Freiheit ausbrütete, nicht mehr in die Kirche ging und alte Sachen liebte, vor allem am eigenen Körper, aber die Stiefel waren dann doch zu schwer, ich bewegte mich wie eine vom Pferd gestiegene Statue, nur zweimal trug ich sie auf dem Schulweg. Als ich klein war und Angst hatte vor dem langsam heranrückenden Beutel, hörte ich an nebligen Sonntagen, bevor der Schnee kam, wie das Pferd draußen scharrte und schnaubte, und ich sah, obwohl es niemand sehen konnte, wie sich der Knecht auf das Pferd schwang und seine Schenkel in die schwarz glänzenden Flanken drückte und mit der Beute davonsprengte, bis Tier und Mensch eins wurden und die dunkle Silhouette im Nebel verschwand: auf Nimmerwiedersehen.
© Leopold Federmair