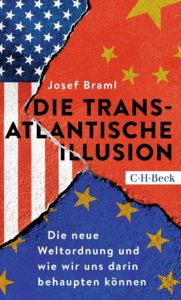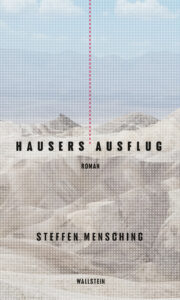
Hausers Ausflug
Nach dem monumentalen, doku-dramatischen Roman »Menschings Augen« aus dem Jahr 2018 über den Gedächtniskünstler, Hellseher und Psycho-Graphologen Rafael Schermann, der in den 1940er Jahren in einem sowjetischen Gulag gelandet war und sein Leben einem Berliner Kommunisten erzählte und, drei Jahre später, den leichten, weltzugewandten Gedichten »In der Brandung des Traums«, legt Steffen Mensching mit »Hausers Ausflug« nun eine anspruchsvolle Melange aus Science-Fiction-Roman und Thriller vor.
»Als David Hauser eines Tages erwachte, fand er sich in seiner AIRDROP-Kapsel zum syrischen Staatsbürger Walid Said verwandelt.« So könnte man – einen berühmten Anfang Beginn dieses Romans erzählen – was der Autor natürlich nicht macht. Die Hauptfigur, David Hauser, 52, seit dem 7. Lebensjahr mutterlos, lebt nach anfänglichem Scheitern als erfolgreicher Unternehmer in Berlin. Man schreibt das Jahr 2029 und Hausers Firma hat eine effektive und sichere Kapsel entwickelt, die abgelehnte Asylbewerber wieder in ihre Heimatländer verbringt – per Abwurf aus einem Flugzeug aus 2000 m Höhe. 10.000 Euro pro Person kostet dem Auftraggeber (es sind in der Regel Staaten) dieser »Transport«, inklusive Kapsel. Hauser gehören auch die Flugzeuge, die er in der letzten großen Pandemie (2024/25) von finanziell notleidenden Fluggesellschaften aufgekauft hatte. Seine Flotte besteht inzwischen aus über 40 Maschinen; mindestens zwei Maschinen pro Tag starten von Parchim bei München mit »Repatriierungen«. Es gab natürlich »nicht wenige Menschen, die ihn verachteten«, aber Hauser stört dies wenig, zumal er sich zurechtlegte, dass viele Flüchtlinge mangels Perspektive in Europa wieder zurück wollten, die Heimatländer jedoch eine Einreise verweigerten.
Plötzlich sitzt er also selber in einer solchen Kapsel; erinnerungslos, wie dies passieren konnte. Nicht nur seine Patek-Philippe-Uhr war verschwunden. Er steckte zudem in anderer, ihm unbekannter, »säuerlich« riechender, Kleidung; lediglich der schwarze Slip von Calvin Klein war ihm geblieben. Das Luxus-Smartphone war zu Gunsten eines älteren Gerätes ausgetauscht worden (Status: »Low battery«). Der syrische Pass, den man ihm mitgegeben hatte, trug sein Foto und sein Geburtsdatum; ausgestellt auf den Namen Waid Said. Hauser bekam den Aufprall mit und findet sich in einer »Mondlandschaft ohne menschliche Spuren« wieder. Immerhin, das »Notfallpaket«, welches jeder Kapsel mitgegeben wird, ist vorhanden: 10 Multivitaminriegel, zwei Wasserflaschen, Schmerztabletten, Sonnenbrille, Handschuhe. In der Kleidung eine Schachtel Zigaretten (Hauser war Nichtraucher geworden), ein Feuerzeug, Zahnseide und zwei S‑Bahn-Fahrkarten aus Berlin.