Es war gar nicht so schwer, all die Urteile und Kritiken zum neuen Houellebecq zu ignorieren. Zumal ich immer weniger dieses Perlentaucher-Efeu-Feuilleton aus FAZ, Zeit, SZ, taz, undsoweiter rezipiere, es interessiert mich fast gar nicht mehr. Sicherlich, ich bekam einige Schlagzeilen mit und dann jene üblichen Verdächtigen, die sich stolz bekannten, das Buch nicht gelesen zu haben, oder jene, die erklärten, warum man dieses Buch nicht lesen braucht, es sei von einem »alten, weißen Typen«, so eine Literaturaktivistin, und man solle besser andere Autorinnen lesen, z. B. Siri Hustvedt, die aber, wenn man genau nachschaut, älter ist als Houellebecq und ebenfalls weiß und ich frage mich nun, ob man Siri Hustvedt als »alte, weiße Typin« oder »alte, weiße Frau« bezeichnen darf, ohne von der Sprachpolizei verurteilt zu werden.
Schließlich gab es noch einen Text, den ich auf Facebook verlinkt fand, der im Teaser vorschlug, das Aufkommen an Houellebecq-Besprechungen und damit die Aufmerksamkeit für diesen Autor bewusst klein zu halten, aber dafür musste auch dieser Text erst einmal Aufmerksamkeit auf Houellebecq lenken, um zu sagen, dass man auf keinen Fall Houellebecq Aufmerksamkeit schenken darf. Und dann, wie mir ein Freund sagte, war da dieser Zeit-Feuilletonist zu der Erkenntnis gekommen, dass Houellebecq ein »neurechter Denker« sei (vermutlich wegen seiner dürren Spenglerrede) und ich dachte an diesen dampfplaudernden ehemaligen Spiegel-Kolumnisten, der seinerzeit Christian Kracht als »Neurechten« diffamierte und danach seufzte ich ob der Lebenszeit, die man mit der Beschäftigung solcher Seins-Nichtse wie Diez oder Soboczynski verschwendet.
Die Erkenntnis, dass die meisten Feuilletonbesprechungen insbesondere was Houellebecq angeht, nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden, keimte bei mir spätestens nach »Unterwerfung« auf. Viele Rezensenten wollten sich mit der in der Geschichte angelegten politisch-gesellschaftlichen Frage, ab wann sich die Demokratie sozusagen selber zum Schafott führt, nicht beschäftigen, sondern deklarierten das Buch einfach zur »Satire«. Andere beschäftigten sich mit der unplanbaren Parallele zwischen Erstveröffentlichung des Buches und den Anschlägen auf die Macher des Satiremagazins »Charlie Hebdo«. Beides hatte wenig bis nichts mit dem Buch zu tun. Dass für derartige Arbeitsverweigerungen die Zustimmungsraten immer mehr sinken, darf niemanden mehr verwundern.
Nun also »Serotonin«. Dem deutschen Leser fällt auf: wieder einmal Stephan Kleiner als Übersetzer. Ich glaube, es gibt inzwischen vier oder fünf Übersetzer von Houellebecq ins Deutsche und ich frage mich, warum es immer wieder ein anderer sein muss. Gibt es dafür Gründe? Wird die Position ausgeschrieben und der günstigste genommen? Aber vielleicht ist das nur ein Nebengleis. Wie üblich wird einem sofort der »Held« des Buches vorgestellt: er heisst Florent-Claude und hasst diesen Vornamen (ich nenne ihn daher nur noch Florent), aber, und das ist durchaus neu, er hasst seine Eltern nicht, im weiteren Verlauf des Buches spielen die Eltern eine wichtige Nebenrolle, aber dazu später.
Florent, der Ich-Erzähler, 46 Jahre alt, lässt den Leser nicht eine Sekunde darüber im Zweifel dass er ein Gescheiterter ist, ein »substanzloses Weichei«, in »unerträgliche Leere« und »friedvoll, gefestigter Traurigkeit« lebend, mit übermässigem Nikotin- und Alkoholkonsum, aber eben inzwischen auch eine Tablette mit dem Namen »Captorix« konsumierend, ein neues Produkt, welches Stimmungen aufhellen soll, ein Anti-Depressiva ohne die gängigen Nebenwirkungen dieser Präparate. Hier kommt Serotonin ins Spiel, jenes Hormon, dass vor allem für die Gelassenheit, den psychischen Ausgleich zuständig ist, und so fühlt sich denn auch Florent, obwohl er eigentlich depressiv ist und sich anfangs beispielsweise nur mühsam zur Körperpflege aufraffen kann.
Zunächst hat man den Eindruck da erzähle jemand aus der Zukunft, denn die Präsidentschaft Macrons wird einmal als in der Vergangenheit liegend gemutmaßt, aber die Rechnereien, die Houellebecq dem Leser anbietet legen den Schluss nahe, dass da jemand aus der Perspektive des Jahres 2018, vielleicht 2019, erzählt und Florent ist damit 1972/73 geboren, in guten Verhältnissen (der Vater war Notar), behütet aufgewachsen. Er studierte auf einer privaten Landwirtschaftsschule, arbeitete in gut dotierten Anstellungen (bei Monsanto und dann im französischen Landwirtschaftsministerium). Obere Mittelschicht also. Zu Beginn der Erzählung lebt er von einem üppigen Gehalt, welches jedoch für Miete einer großen Wohnung in Paris und das Aushalten seiner japanischen Geliebten namens Yuzu zu 90% aufgebraucht wird. Daneben besitzt er ein Erbe, welches einen Kontostand von rund 700.000 Euro ausweist.
Nach kurzem Vorspiel beginnt es mit der Schilderung der Loslösung von Yuzu. Interessant, dass ausgerechnet sie die einzige Protagonistin im Buch ist, die man als Profiteurin der Globalisierung bezeichnen könnte, denn solange sie in Frankreich lebt, leben kann (ihr Gehalt ist bei weitem nicht ausreichend für ihr Luxusleben), muss sie nicht zurück nach Japan, wo wohl schon eine arrangierter Ehe auf sie wartet. Beide haben sich jedoch entfremdet, er schläft schon länger nicht mehr mit ihr aber als er auf ihrem PC pornografische Videos entdeckt (vom Gangbang in seiner Wohnung bis zur Sodomie ist alles dabei), beschliesst er, sie zu verlassen und sozusagen rückstandslos zu verschwinden. Er gibt seinen Job auf, kündigt die Wohnung und besorgt sich bei einer anderen Bank ein neues Konto. Das geht binnen eines Tages. Schwieriger – drei Tage! – ist es, ein neues Domizil zu finden. Der chronische Nikotinsüchtige benötigt ein Raucherzimmer, was, wie sich herausstellt, kompliziert ist, zumal auch noch der Pariser Bezirk der neuen Wohnstatt nicht ganz unwichtig ist. Als er sein Hotel gefunden hat, verschwindet er aus seiner Wohnung und lässt Yuzu gruß- und mitteilungslos zurück.
Die individuelle Zerstreuung Sex, die in Houellebecqs Romanen immer eine wichtige Rolle spielte, verflüchtigt sich für den Protagonisten des neuen Romans. Der »Kern seines Seins« schimmert nur noch zu Beginn hervor, wenn er an einer Tankstelle in Spanien zwei jungen Frauen hilft, den Reifendruck ihres Fahrzeugs zu überprüfen und dabei von einer Erektion »befallen« wird. Dies geschah vor der »Captorix«-Therapie, die zwar die latent drohende Selbsttötungsneigung bei Anti-Depressiva verhindert, dafür aber die Libido fast vollständig zum Erliegen bringt. Das hindert Florent zwar nicht von den ihren sexuellen Vorzügen seiner ehemaligen Geliebten zu erzählen, aber der Held, so hat man das Gefühl, erzählt von einer sehr fernen Zeit, ähnlich einem Bergsteiger, der seit Jahren nicht mehr das Haus verlassen hat. Da helfen auch die wuchtig eingestreuten Vulgarismen wie »Schlampe«, »Möse« oder ähnliches nicht mehr – es bleibt maulheldenhaft und vielleicht, so denkt man als Leser, möchte der Autor nur ein bisschen provozieren und das dürfte bei den blankliegenden Nerven der Sprachkorrekten ganz gut funktionieren.
Geblieben ist das letzte Abenteuer der 10er Jahre des 21. Jahrhunderts: Das Rauchen. Es ist für Florent geradezu eine heroische Widerstandsgeste gegen die Gesellschaft, den Rauchmelder in Hotel- oder sonstigen Schlafzimmern unbrauchbar zu machen und wo dies durch die Deckenhöhe von 4 Metern nicht geht bleibt nur die Übernachtung auf dem Balkon. Da ist sie, die Diskrepanz zum deutschen Leser, der in den Diskussionen der letzten Monate als ultimativ letzte Freiheit das Autofahren ohne Tempolimit angedient bekommt.
In einer Mischung aus Sentimentalität, Langeweile und Neugier begibt sich Florent auf eine Art Abschiedstournee und sucht ehemalige Geliebte und Freunde auf. Den Anfang macht eine gewisse Claire, eine immer noch arbeitslose, inzwischen dem Alkohol verfallene Schauspielerin, mit der ihm, wie er feststellen muss, nichts mehr verbindet (wie gesagt: der Sex scheidet aus; Claire scheitert). Dann geht er in die Normandie und besucht Aymeric, einen Studienfreund, der sich gegen einen gut bezahlten Job in der Industrie entschieden hatte und nun Milchwirtschaft nach ökologischen Regeln betreibt. Mehr als ein Jahrzehnt ist seit seinem letzten Besuch vergangen, und Aymeric ist inzwischen »verdrossen, verstockt und verzweifelt«, auch er Alkoholiker, die Frau ist mit den beiden Kindern weg. Die Freunde schweigen, trinken und berauschen sich an einer Aufnahme von »Child in Time« 1970. Aymerics Ideale sind noch da, die Kühe werden von Hand gemolken, bekommen kein Turbofutter, die Einnahmen sind aber bescheiden und auch die Bungalow-Vermietung auf dem großen Grundstück funktioniert nicht (nur ein pädophiler Deutscher bewohnt eines der Häuser). Als die EU die Milchquoten abschafft, stehen die Bauern vor dem Ruin. Es kommt zum Thomas-Müntzer-mässig inszenierten Aufstand, zur Konfrontation mit der Polizei. Zehn Landwirte sterben, Aymeric bringt sich um. Florents Schockzustand ist von kurzer Dauer.
Immerhin: Zwei Frauen waren da, zwei Möglichkeiten, sein Glück zumachen. Beide Male gescheitert. Da war Kate, mit der man »die Welt [hätte] retten können«, die er aber in einem entscheidenden Moment einen Augenblick zu spät angerufen hatte. Und dann Camille, die ehemalige Praktikantin, zehn Jahre jünger, mit der er fünf Jahre zusammengelebt hatte, die »schönsten Jahre« seines Lebens. Vorbei. Und das nur, wegen Tam und ihrem »hübschen kleinen schwarzen Hintern«.
Camille hat sich als Tierärztin niedergelassen. Er findet und beobachtet sie und ihre Kinder (unter anderem einen vierjährigen Jungen) nun über Wochen, traut sich nicht, sie direkt anzusprechen. Sie lebt alleine; kein Mann, kein Geliebter in Sicht. Irgendwie kommt er auf die Idee den Sohn zu erschießen um dann als emotionaler Retter aufzutauchen und da bekommt das Buch für kurze Zeit eine Wendung, die einem fast das Blut in den Adern gefrieren lässt, denn mit welcher perverser Schein-Logik der Ich-Erzähler den Mord an dem Kind rechtfertigt als er den Kleinen beim Puzzlespielen auf der Terrasse im Visier seines Geweht hat, ist wirklich schockierend, viel schockierender als das provokative Herumgerede über »Schwänze« und den Tourismusgiganten Franco.
Der Rezensent ist nun in dem Dilemma die Auflösung mitliefern zu müssen oder den Leser aufzufordern, nicht weiter zu lesen. Denn zum Mord kommt es nicht, was man erahnen kann, da für Florent vorher bereits Schießübungen mit beweglichen Zielen wie Vögeln nicht möglich waren. Er fährt indessen nach Paris, braucht ein neues Rezept für sein Psychopharmaka. Da ist der Roman auch schon fast zu Ende, noch 30 Seiten schleppt er sich dahin, Houellebecq hatte wohl keine Lust mehr, lässt seinen immer mehr verfetteten Protagonisten (noch eine Nebenwirkung des Medikaments) eine Wohnung in einem anonymen Hochhausviertel in Paris beziehen, wo er mit den noch verbliebenen 200.000 Euro (die Hotelaufenthalte!) sich buchstäblich zur letzten Ruhe, in der nur noch der Sport und die Naturdokus im Fernsehen von Interesse sind (später nicht einmal mehr der Sport), niederlässt aber immerhin – eine letzte Aktion – eine Wand mit Ausdrucken der Fotos seiner glücklichsten Augenblicke tapeziert und er imaginiert schon den Makler nach seinem Ableben, wie er für einen kurzen Moment erstaunt über diese Fotowand ist und dann den Auftrag zur Entfernung gibt.
Man kann und muss dieses Buch kritisieren, man kann es womöglich ablehnen, kann diese Sprache furchtbar finden, die Figur erbärmlich, die EU- und Globalisierungskritik, die in Nuancen durchschimmert, banal, die inflationär eingesetzten Markenproduktnamen fragwürdig, die detaillierte Topographie von Paris und der Normandie langweilig (und man kann, mit ein bisschen Geschick, die letzten beiden Stilmittel auch erklären). Und ja, literarisch ist es dürftig. Aber unter diesen Schichten, zwischen diesen Tiraden beispielsweise auf die Holländer, die Deutschen, Thomas Mann und Marcel Proust, das »Rindvieh« Goethe, die »umweltbewußten Kleinbürger«, kurz: auf Gott und die Welt, diesem Gemaule, das manchmal an (den späten) Thomas Bernhard erinnert und sich dann doch so groß davon unterscheidet, denn Florent ist wie auch beispielsweise Bruno aus »Elementarteilchen« oder auch die namenlose Hauptfigur aus dem »Kampfzone«-Roman ein verdeckter Romantiker, ein Sehnsüchtiger, der nicht nur verzweifelt ist, sondern auch verzweifelt versucht, nicht in Zynismus abzudriften und das ist der Unterschied zu den Figuren Bernhards, die mit ihrem eingängigen Witzeltum die Feuilletonstuben amüsieren und eine besondere Verachtung für den »Kleinbürger« darstellen, darin sind sie sich einig, Houellebecq und Bernhard, freilich eine fragile Gemeinsamkeit.
Wenn Florent dann erzählt von seinen Eltern, diesem stillen Einverständnis zwischen den beiden, dem, was man trivial oder treffend »Liebe« nennen könnte, und dann dem unheilbaren Gehirntumor des Vaters (er ist 64, die Mutter 59) und deren gemeinschaftlicher Selbstmord in Stefan-Zweig-Manier, händchenhaltend, dann spürt man plötzlich diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach dem Einssein mit einer Welt und vor allem die Wehmut über die verpassten Chancen mit Kate und Camille, eine Wehmut, die man fast als Kitsch denunzieren könnte, aber sie ist so gut versteckt, dass sie kaum auffällt. Und dann ist der mit vulgärer Volte vorgebrachter Ratschlag an Aymeric nicht mehr so abwegig, die Milchwirtschaft und all seine hochgesteckten, aber von der Gesellschaft eher gleichgültig betrachteten Ambitionen aufzugeben, sich eine Frau werweisswoher (Moldawien vielleicht) zu suchen und mit ihr und ihren bescheidenen Glücksbedürfnissen in Frieden und Harmonie in Symbiose mit einem eigentlich verhassten Finanzkapitalismus zu leben.
Florent ist, so wie ihn der Dichter schildert, eigentlich eine Spur zu klug für diesen ostentativen Selbsthass, was nichts weniger als das literarische Unvermögen des Dichters Houellebecq aufzeigt, Situationen und Stimmungen zu zeigen, zu evozieren, statt sie dauernd zu erklären, zu behaupten. So macht er aus Florent einen Jammerlappen, der sich in seinen selbsterfüllenden dystopischen Prophezeiungen einrichtet. Es ist ein Innerlichkeitsroman, aber seine Innerlichkeit ist anders langweilig wie die der Innerlichkeitsliteratur in den 1970ern – sie ist vorausberechenbar, fatumhaft, ausweg- und trostlos. Es ist natürlich das gute Recht eines Autors, seine Figur derart vorzuführen. Aber es ist schon fatal, dass damit Entfremdungsszenarien der Gegenwart derart fahr- wie nachlässig diffamiert werden.
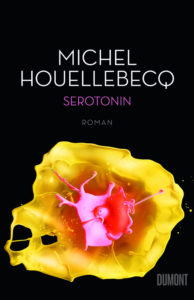
Ich kann das hier ausführlich Beschriebene gut nachvollziehen, verstehe aber den letzten Satz nicht recht: Warum werden Entfremdungsszenarien diffamiert, wenn sie literarisch dargestellt werden?
Vor ein paar Jahren hat einmal ein akademisch Tätiger eine Umfrage unter Houellebecq-Übersetzern verschiedener Sprachen gemacht. Damals meinte ich, Houellebecq sei ein Autor unter anderen, also gar so besonders auch wieder nicht (und ich meine damit, wenn ich es jetzt wiederhole, seine Bücher seit »Plateforme«, nicht die beiden ersten Romane). An der knappen Reaktion des Akademikers merkte ich sein Erstaunen über meine Äußerung.
Unlängst habe ich in einem Artikel über die Aufnahme von H.s neuem Roman in Frankreich in der Einleitung gelesen, er schreibe »teuflisch gut« (und dann kamen alle möglichen Abers, Politik und so). Ich finde es erfrischend, wenn Keuschnig dagegen feststellt, die Sprache des Romans sei »furchtbar« , der Roman literarisch »dürftig«. Zu »Serotonin« bin ich noch nicht bekommen, aber »Unterwerfung« fand ich auch mäßig, man kann sowas geschwind lesen, es bietet kaum Widerhaken, literarisch ist mir das zu glatt, die Provokationen scheinen berechnet und wirken daher – zumindest auf mich (und auf Keuschnig) – nicht als solche.
Was Keuschnig über H.s romantische Sehnsüchte schreibt, trifft m. E. zu, auch, dass sie im Verlauf von H.s Karriere in den Hintergrund gerückt sind, unterschwellig geworden sind. Verdrängt, das ist meine Erklärung, verdrängt durch medienbezogenes Kalkül (immer wieder kommen Mediengestalten vor, auch Politiker etc., die entweder benannt werden oder identifizierbar sind). Das war bei H. am Anfang natürlich nicht so, sowas kann man erst ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad machen (auch Th. Bernhard machte es, erst relativ spät, ich glaube, er war schüchterner als H., krankhaft schüchtern (und zugleich arrogant)). Im Anfang war bei H. (und bei Th. B.) ein offenes Leiden an der Existenz, ein Gefährdetsein, tiefe Verletzung. Aus dieser Erfahrung heraus schreiben sie, diese Erfahrung ist die paradoxe Kraft- und Inspirationsquelle. Sie kann sich allerdings erschöpfen, und wenn sie nicht durch anderes ersetzt wird, kann es sein, daß der Schmerz zu bloßem Ressentiment wird, das die Kreativität mindert.
Ohne den neuen Roman gelesen zu haben: Womöglich ist die romantische Sehnsucht altersweise geworden oder will das zumindest sein, Philemon und Baucis, oder besser, Candide, nach anstrengender Lebensreise und Gesellschaftskritik sich in den Garten zurückziehen, den zu bestellen die letzten Freuden vor dem Ende bietet. That’s life, boy!
Mit »diffamieren« meine ich, dass die Entfremdungserfahrungen von der Welt zu Gunsten von Pointen und Provokationen sozusagen »geopfert« und sehr weit in den Hintergrund geschoben werden. Ich möchte damit natürlich nicht den Weltschmerz-Orgien der 1970er-Jahre und dem plakativen Aktivistentum der Gegenwart das Wort reden, aber das ist mir dann doch zu glatt, zu sehr auf Affekt gebürstet.
»Unterwerfung« bot durch den Subtext der sich selbst abschaffenden Demokratie eine gewisse Widerborstigkeit. Und es wurde der Opportunismus der Mittelschicht gezeigt, ein Opportunismus, der sich allzu leicht in Anpassung und Zustimmung verwandelt. In »Serotonin« sind alle Protagonisten Gescheiterte, selbst ein Hausbesitzer, der Florent ein Haus vermietet, outet sich als gescheiterter Architekt. Interessant wäre es zu erzählen, wie es zu diesem Scheitern gekommen ist. Stattdessen wird dann »der Staat« oder »die Regierung« dafür verantwortlich gemacht. Das kann der Protagonist natürlich glauben, aber es verschafft dem Leser keine Befriedigung; diese Form der Zuordnung ist dann fast groschenheftartig. Das finde ich schade, weil Houellebecq durchaus einen Nerv treffen könnte, aber ich glaube, dass er mit seinem literarischen Vermögen entweder an sich selber scheitert (sic!) oder er es nicht möchte.
»Ausweitung der Kampfzone« und »Elementarteilchen« hatten etwas Krudes, außergewöhnlich Direktes, bestimmte Phänomene, die jeder kannte, aber niemand zu benennen wußte, wurden regelrecht aufgespießt. In der Komposition war das oft schräg, waghalsig. Jetzt erzählt er halt so dahin, meist im Plauderton, Mono- oder Dialog. Er ist »zu gut« geworden, verarbeitet Stoffe, die ihm die Medien zuspielen (oder zuspülen, wie die Dünung). So empfand ich es bei »Unterwerfung« oder »Karte und Gebiet«, Romane, die bei mir nicht viel hinterlassen haben. Ich weiß nicht, ob es Übersetzer gibt, die sagen, nachdem sie von einem Autor einiges übersetzt haben: Dieses neue Buch mache ich nicht, es reizt mich nicht, bedeutet keine Herausforderung. Oder ob sie sich darum reißen, einen Autor zu übersetzen, über den alle Welt spricht. Mitverdienen tut man auf alle Fälle, bei sehr hohen Auflagen.
Diese Wandlung sehe ich auch. Daher kam ich auf Thomas Bernhard, wo es ähnlich war.
»In »Serotonin« sind alle Protagonisten Gescheiterte«. Audrey (nicht Hepburn) vom Hotel Mercure wird jetzt nicht sooo negativ dargestellt.
Ja, stimmt, und der Chef des Hotel, der Florent eine Gnadenfrist für sein Raucherzimmer einräumt, ist es auch nicht. Aber Audrey und ihr Chef sind keine Hauptfiguren...
Interessanter wäre die Frage ob Camille derart eingestuft werden kann. Aus Sicht des Protagonisten sicherlich – man lese die Schimpfrede auf die »Patchworkfamilie«.
Ich kann Ihnen weitestgehend folgen, meine aber noch einen anderen Aspekt gesehen zu haben.
Weil ich es ungefiltert hören wollte, habe ich mir mal die »Vordenker« der Identitären Bewegung (die ja aus Frankreich kommt) im O‑Ton angesehen. Die wesentlichen Topoi sind neben dem definierenden Ethnopluralismus die Vorhersage des Untergangs der Gesellschaft, auf den man warten muss, damit wieder etwas Neues entstehen kann, die allumfassenden Einschränkungen der persönlichen Rechte, die Einschränkung der Meinungsfreiheit.
All das atmet das Buch, zumindest hat es sich mir so aufgedrängt. Die untergehende Bauernschaft, das als Bevormundung empfundene um sich greifende Rauchverbot, die Sprechverbote und all das gewürzt mit etwas Heidegger. Das soll jetzt nicht heißen, dass Houellebecq ein Neuer Rechter sei, aber er spielt mit den Ideen. Der Vorwurf der Identitären an die Gesellschaft ist, dass man zwar erkennt, dass etwas falsch läuft, man sich aber nicht zur Wehr setzt, sich arrangiert oder untergeht. Nun ja, Florent geht wie so viele Andere unter, legt sich wie ein sterbendes Tier in einen Unterschlupf. Dazu passt der Markenfetischismus und die Anbetung an den wohlsortierten Supermarkt. Das ist nicht messerscharf, ich meine aber diesen Sound gehört zu haben.
In der Kritik fand man natürlich die üblichen Verdächtigen und ihre Plattitüden, aber auch erstaunlich abgeklärte Ansichten. Vor allem hat mich die taz überrascht, die ich normalerweise nur mit Herztropfen ertrage. Doris Akrap hat tatsächlich auf all das Erwartbare verzichtet.
Naja, der Text von Frau Akrap ist doch sehr im taz-Meinungstunnel angesiedelt; ihre Interpretationen wirken ein bisschen aufgesetzt. Da west der Wunsch nach neuen Männern für das Land durch. Und da ist sie sich ja sogar einige mit Houellebecq.
Es würde sich lohnen die Spengler-Rede Houellebecqs eingehend zu analysieren. Sie ist nur im Bezahl-Modus der »Welt« lesbar und ich fürchte, es würde den Verantwortlichen nicht gefallen, wenn ich sie hier ellenlang zitieren würde. Die Rede ist m. E. sehr dürftig und bedient tatsächlich eine Mischung aus Weltuntergangslust und ‑leid. Es ist dieser Spannungsbogen bei Houellebecq, der das halbwegs erträglich macht.
Der Untergang der westlichen Gesellschaft wurde ja schon in »Unterwerfung« explizit und lustvoll verzogen. Als Ersatz trat hier das alte, neue Versprechen: die Religion (in Form des Islam). Die nahm man an, weil sie Vorteile versprach. Auch in den Büchern zuvor war das Sozialleben der westlichen Menschen eigentlich kaputt und konnte perspektivisch an künstliche Lebewesen delegiert werden. Die Parallelen zu den Identitären sind in »Serotonin« sicherlich greifbar. Wobei ich glaube, dass Houellebecq den zweiten Teil des Plans, das »Neue«, nicht besser findet. Ich finde, dass hat mehr mit Fin de Siècles zu tun als mit identitärem Denken.
Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das nächste Buch in vier oder fünf Jahren aussehen soll. Und ob man es dann überhaupt noch lesen will.
In »Unterwerfung« wurde die westliche Gesellschaft von einer fremden Kultur gekapert. Die IB sieht eher das Samenkorn, das noch keimen kann. Vielleicht so wie Florent in dem Restaurant den Bauern Aymeric als »unseren Herrn« in den Mund legt. Und die Vision jeden Morgen in dem Haus am See auf zuwachen, hört sich schon sehr paradiesisch an (Sie schrieben bei Camille von Kindern, ich habe nur von einem Vierjährigen gelesen).
Die Chuzpe einer Vorhersage habe ich nicht. Aufgrund des neuen Figurentypus der Camille ist Altermilde nicht mehr ganz unmöglich? Und Lesen werde ich es auf jeden Fall.
Ich habe ähnlich wie Gregor in den älteren Büchern eine literarische Begrenzung gefunden. Stimmungen und Gemütsbewegungen erscheinen immer nur punktuell als Behauptung, ich finde keine Bögen, keine Atmosphäre, keine Entwicklung in den Situationen.
Es fehlt (riskante These) eine Zentralfigur, an die der Leser andocken könnte. Denn ein Ich-Erzähler stellt zunächst eine klare Einladung dar, aber die Identifikation resp. Empathie fällt schwer. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Vielleicht ist das Gleichgewicht zwischen Sentimentalität und Einsamkeit/Entfremdung ja doch misslungen. Es fehlen komplett die »thymotischen Energien«, also Stolz, Trotz, Aggression, Überwindung, etc. Die Parallele zwischen dem persönlichen und dem kollektiven Scheitern wirkt penetrant und unrealistisch.
Ich bin ein Anhänger der Theorie von Deleuze, dass im Roman eine Figur (sehr selten zwei!) wichtiger ist als alle anderen. In einem sehr allgemeinen Sinne muss es einen Helden geben. Er oder sie kann auch ganz furchtbar scheitern, und teilweise höchst unangenehme Eigenschaften haben. Aber die Möglichkeit, den Helden zu mögen, muss gegeben sein. Dieser Anker fehlt, und die Folge ist eine Minderwertigkeit des gesamten Personals. Die Figuren sind Zwerge, von Klischees umlagert, die fehlende »Mutterliebe« des Autors bestraft sie alle gleichermaßen.
Das ist bestimmt kein Konzept, keine erzählerische Absicht. Das ist eine Beschränkung.
die_kalte_Sophie
Naja, bei Houellebecq gibt es schon immer eine, mindestens eine (in »Elementarteilchen« zwei) Hauptfigur(en), die auch ziemlich dominant ist. Und ich glaube auch dass das Identifikationspotential insbesondere bei männlichen Lesern sehr gross ist. Ein bisschen spielt er auch mit der politischen Unkorrektheit, was zusätzlich einerseits Pluspunkte bringt, andererseits Proteste provoziert.
In »Serotonin« wechselt bei mir das Interesse zwischen Mitleid und Unverständnis. Und dann natürlich das Gefühl, es noch nichts so dreckig zu haben wie Florent. Generell wäre aber die Frage interessant, warum und was an Verlierern in der Literatur interessant ist. (Es zu benennen wäre die Kunst; nicht ex negativo zu antworten wie »Gewinner sind langweilig«.)
PS: die interessanteste Figur ist sein Freund Aymeric. Er macht eigentlich alles, was das »korrekte« Frankreich von ihm verlangt: nachhaltige Landwirtschaft, Familienleben, ökonomische Investitionen. Und hier ist es der Staat, der ihm seine Grundlagen entzieht: Der Milchpreis wird nicht mehr garantiert – die Basis seiner Existenz zerbröselt. Den Rest erledigt er dann selber noch. Seine Aufruhr ist eine Mischung aus Wilhelm Tell und Thomas Müntzer. Als er sieht, dass der Staat zur Not auch auf ihn schiesst, zieht er die Konsequenz für sich selber.
Die Idee, einen Verlierer zum Helden zu machen, ist eigentlich ganz gut. Ich habe ja vorsichtig formuliert: nur die Parallele zwischen dem persönlichen und dem kollektiven Scheitern ist tückisch. Wir müssen die Hauptfigur ja diesbezüglich befragen. Woran genau scheitert Florent?!
Man denkt unwillkürlich an die alten Buchtitel: Falsche Versprechen! Die Versprechen der Beschleunigung, der Freiheit, der Partizipation, der Selbstoptimierung, des Lustprinzips, sogar das Versprechen der »Individualität«, also einer mutmaßlichen Unabhängigkeit des Egos vom sozioökonomischen Komplex.
Diese Figurenabstraktion finde ich zwar psychologisch interessant, aber sie geht wie ein Feuerwerkskörper nach hinten los. Ich wäre der Erste, der applaudiert, wenn’s gelingt, aber der Bezugsrahmen dieser »westeuropäischen Mannsperson« ist zu weit gespannt.
Aymeric wäre (als Hauptperson) schon eher beherrschbar, Houellebecq hat sogar das nötige Hintergrundwissen dafür.
Verblüffend, dass die Landwirtschaft eine Doppelrolle spielt, sie hat einen ökonomischen Protagonisten, eben Aymeric, und einen bürgerlichen Protagonisten, eben Florent. Ein Realo und ein Fundi, im Sinne des Bedenkenträgers. Sie scheitern beide, aber der Bürgerliche ist von Anfang an der kaputte Typ. Sieht so aus, als würde H. nicht vor dem Untergang der Nation warnen, sondern schlicht und einfach vor dem Ende des Staates als gemeinschaftsbildende Ordnungsmacht.
Wer hätte nicht schon daran gedacht, dass all die partikularen und subversiven Mächte irgendwann den großen Riesen stürzen könnten?!
Ich habe mich nach etwas zeitlichem Abstand von der Lektüre (in Originalsprache) von »Serotonin« an einer Kurzrezension versucht:
Der Antiheld berichtet von seiner verzweifelten Suche nach sexueller Be-fried-igung und auch sonst Zu-frieden-heit in einem reduzierten Gemeinschaftsleben innerhalb der heutigen Welt in Frankreich.
Diese beschreibt er „en passant“ auf sensible Art kritisch, wobei er alle emotionalen Register verwendet.
Sein Charakter sowie die Zustände in dieser westlichen Welt erlauben ihm jedoch nicht, ein für ihn lebenswertes Leben zu finden.