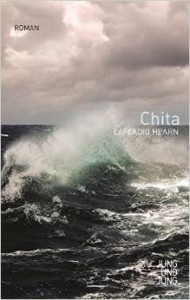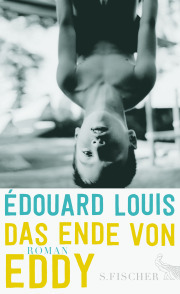Über das Fortwirken von Hofmannsthals Chandos-Brief
Für Gregor Keuschnig,
und auch für Akira Hotta, zur Ermunterung
Einer der Texte, die ich oft wiederlese, teils am Leitfaden des Zufalls, beim Streunen zwischen den Büchern, dann wieder angeregt durch Kollegen, ist der Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal. Ein bei Autoren beliebter Text, der sich gut zum Zitieren eignet; man kommt nicht um ihn herum. Bei meiner neuesten Lektüre habe ich ihn mehr als früher als Erzählung gelesen, als Geschichte mit relativ weit gespanntem Erzählbogen, der dann in der Gegenwart kulminiert, in den Augenblicken der Epiphanie. Kulminiert wie eine Brücke, die plötzlich abbricht, ins Nichts führt – nicht in eine helle oder düstere Zukunft, die wir ahnen, sondern ins Nichts.
Dieser Lord Chandos ist ein junger, begüterter Mann, einstmals Schüler des bedeutenden Philosophen Francis Bacon, dem er nach langer Schweigezeit nun einen Brief schreibt, den letzten, wie man vermuten muß. Chandos ist ein Schriftsteller, ein Dichter, der mit seinen Schäferspielen einigen Erfolg hatte und nun mit seinem Latein am Ende ist. Die Schäferdichtung war ein beliebtes Genre im Humanismus, also jener Kultur, der Bacon und Chandos entstammten; es wurde noch im Barock und Rokoko eifrig bedient. Derlei Idyllen kann Chandos nun nicht mehr schreiben, und auch sein episches Großprojekt – in der Art eines Vergil, mag man sich vorstellen – ist gescheitert. Das ehemalige Talent steht nun also mit leeren Händen da. Chandos befindet sich nicht nur in einer Schreibkrise, sondern in einer radikalen Sprachkrise – um das Zauberwort zu gebrauchen, das die Leser, Autoren und Germanisten und Kritiker, bis heute gern und oft etwas gedankenlos verwenden. Die Interpretation eines dieser berufsbedingten Chandosbriefleser will besonders originell sein und läuft darauf hinaus, daß der gereifte Chandos künftig jeder Originalität entsage, das Dichten sein lasse und sich seinen Landgütern widme. Das wäre nun eine ruhige, sinnvolle, der Gesellschaft dienliche Art des Verstummens, die in der Literaturgeschichte tatsächlich ein anderer Dichter vollzogen hat, kein fiktionaler, sondern ein historischer: Arthur Rimbaud.
Diese Lektüre übersieht, daß Chandos leidet; der Ton seines Briefes deutet eher darauf hin, daß das Leiden unheilbar ist. Chandos ist in eine Krise geraten, die er nicht, vielleicht nie mehr, zu lösen, der er nicht zu entgehen vermag. Seine Krise ist in Wahrheit eine Katastrophe, ein Zusammenbruch. Allerdings darf man nicht übersehen, wie es ebenfalls einigen Lesern unterlaufen ist, allen voran Hermann Broch, daß der Chandos-Brief keineswegs nur »negativ« ist. Nein, er enthält zahlreiche lichte Augenblicke, Erlebnisse, die offenbar nur deshalb stattfinden können, weil er sich der Katastrophe ausgesetzt hat, statt ihr, wie es weniger radikale Autoren tun mögen, den Rücken zu kehren und sprachliche, in letzter Instanz also: gesellschaftliche Kompromisse zu schließen. Broch hat diese Erlebnisse, in denen das wahrnehmende Subjekt sich in der umgebenden Welt der Dinge aufzulösen scheint, als Schritt in den Wahnsinn bezeichnet. Auch darin kann ich ihm nicht folgen. Will man überhaupt so etwas wie ein Aufgehobensein in der Welt erfahren, hat man sich zuvor einer Reihe bequemer Sicherheiten und pragmatischer Orientierungen zu begeben. Chandos tut dies, indem er auf Kommunikation zugunsten von schweigend-sprechender Kommunion verzichtet. Nebenher bedient er sich weiter der gängigen Sprachformen, er ist durchaus imstande, seine Geschäfte zu erledigen und so zu tun, als verbände ihn noch etwas mit der bürgerlichen Welt. Daß er im Brief an Francis Bacon seinen Erlebnissen in der Begegnung mit kleinen, unscheinbaren Dingen sprachlichen Ausdruck gibt, ist ein performatives Paradox. Chandos sagt nämlich das, was er nicht sagen kann.
Weiterlesen ...