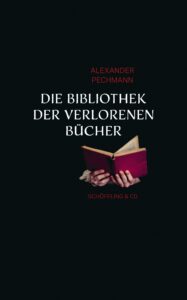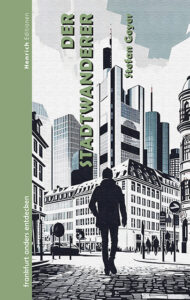
Der Stadtwanderer
»Denn tatsächlich ist es nicht möglich, längere Zeit zu gehen und zu denken in gleicher Intensität, einmal gehen wir intensiver, aber denken nicht so intensiv, wie wir gehen, dann denken wir intensiv und gehen nicht so intensiv wie wir denken…«, so Oehler, Thomas Bernhards Protagonist aus Gehen, aber da ist jemand, der damit nichts anfangen kann, und das ist Stefan Geyer. Er dockt eher bei Robert Walser, Carl Selig oder Erich Kästner an, bekennt, einst von einem Buch des Norwegers Erling Kagge zum Gehen angeregt worden zu sein und beschäftigt sich mit der »Spaziergangswissenschaft« von Lucius Burckhardt.
»Ich gehe, um zu gehen«, so lautet der oberste Grundsatz der Geh-Philosophie des ehemaligen Suhrkamp-Mitarbeiters, der mehr die Vokabel des Spazierens als die des Wanderns bevorzugt, auch wenn es schon mal 20 km sind, die da in und um Frankfurt herum zurückgelegt werden. Und das unabhängig vom Wetter; manchmal regnet es und gerade das motiviert ihn, auch, wenn er vielleicht mit einem Kater aufwacht. Dann findet sich bei ihm in den sozialen Netzwerken die fast meditative Eintragung à la »Schuhe schnüren, herumgehen, Kopf lüften« (im Sommer vielleicht noch ergänzt um ein »Hut auf«) – nicht selten, wenn man selber froh ist, bei diesem Wetter nicht vor die Tür zu müssen.
Der Extrakt seiner Spaziergänge liegt nun unter dem Titel Der Stadtwanderer vor, fünfzehn Texte mit Schilderungen durch bekanntes und unbekanntes Terrain, querstadtein durch Straßenzüge, Kleingartenanlagen, Einkaufspassagen, Feld- und Wiesenwege, irgendwann zwischen Ende 2021 und der unmittelbaren Gegenwart. Wer wie ich als gelegentlicher Buchmessenbesucher nur das Messegelände und die Gegend um den zur exterritorialen Drogenszene mutierten verwahrlosten Frankfurter Hauptbahnhof kennt, soll eines Besseren belehrt werden.