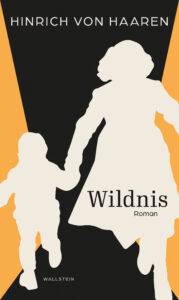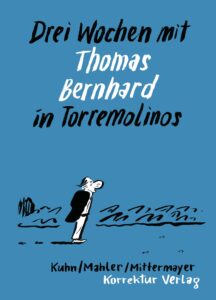Sisyphos stirbt nicht, er kehrt immer wieder zurück. Und wir kehren zu ihm zurück. »Ohne sein sinnloses Drama wäre das Leben sinnlos«, behauptete der mexikanische Dichter José Emilio Pacheco einst. Inmitten all der Hypes, die über unsere Displays rauschen, meldet sich das alte Gefühl des Absurden zurück.
Sisyphos im Maschinenraum ist kein Roman, auch als Essay würde ich das Buch nicht bezeichnen. Die Verfasserin, Martina Heßler, ist Professorin für Technikgeschichte, und sie stellt keine literarischen Ansprüche. Dennoch bezieht sie sich am Ende ihres Buchs, und auch am Anfang, auf Albert Camus, und zwar auf dessen Vorstellung eines glücklichen Sisyphos, der die Absurdität seines Tuns – einen Stein auf einen Berggipfel rollen – akzeptiert, mit seinem Schicksal also einverstanden ist. Heßler meint, Sisyphos könnte den Stein doch einfach mal liegen lassen. Das heißt, im zeitgenössischen Kontext, die Technologien nicht immer weitertreiben, Unzulänglichkeiten akzeptieren, sowohl aufseiten der Maschinen als auch aufseiten der Menschen.
Heßler fokussiert stark auf Fehlerhaftigkeit. Das gehört nun mal zu akademischen Studien, man muß sein Forschungsfeld genau eingrenzen, Definitionen liefern, möglichst erschöpfende Darstellungen des Gegenstands. Daß Techniken und Technologien ihre eigene Entwicklungslogik haben, unabhängig von Fehlern und Reparaturen, weiß sie wohl, macht es aber kaum geltend. Offen gestanden, mir scheint die Figur des Sisyphos für die Technikgeschichte und letztlich für alle anderen Geschichten nicht recht passend; sie scheint auch nicht passend für die Lebensnotwendigkeit kapitalistischer Gesellschaftssysteme, Profite zu maximieren. Ohne Steigerung gibt es hier (angeblich) keine wirtschaftliche Existenz. Daher die Schwierigkeit, bei schrumpfender und alternder Bevölkerung wie etwa in Japan das System langsam zurückzufahren, ohne es als Ganzes ins Trudeln zu bringen.
Die Autorin zeigt sich skeptisch gegenüber der Idee eines kontinuierlichen Fortschritts, und wer würde solche Skepsis heute, am Ende des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts und rückblickend auf das zwanzigste, nicht teilen. Aber die Menschen als Akteure und Opfer der Geschichte, die sie gleichzeitig »machen«, rollen nicht immer denselben Stein auf immer denselben Berg. Sie ändern ihre Werkzeuge und ändern damit auch ihre Umwelt, nicht zwangsläufig zum Besseren, oft auch zum Schlechteren; sie schaffen großartige Dinge und richten ungeheures Leid an – von beidem singt das 20. Jahrhundert ein Lied, das im 21. leider nicht verklungen ist. Vielleicht ist es besser, auf überlieferte Sinnstiftungsquellen zu verzichten und einfach so weiterzumachen, ohne Sinn und Zweck, dem Lebenstrieb folgend.