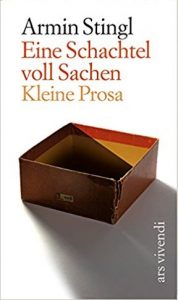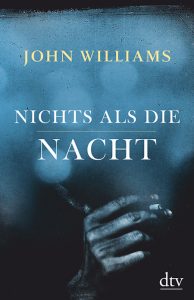
Vor vier Jahren gelang mit der Neuübersetzung von John Williams’ 1965 erstmals publiziertem Roman »Stoner« im deutschen Feuilleton etwas sehr Seltenes: Von der Hochkritik bis in den Boulevard hinein gab es nur Lobeshymnen. »Stoner« bot auf allen Ebenen Identifikationspotential, insbesondere für den Intellektuellen, der Zeit seines Lebens in der Universität (oder eben in Redaktionsstuben) seiner intellektuellen Integrität treu geblieben war. Das Leben des Universitätsdozenten Stoner war geprägt aus der Diskrepanz der Leidenschaft des Intellektuellen für seine Arbeit und dem realen Leben. Im Gegensatz zum deutschen Faust blieb sich Stoner treu. Sein Scheitern (Verlust der Freunde, unglückliche Ehe, alkoholkranke Tochter, ausbleibender akademischer Ruhm nebst Universitätsintrige) wurde als Lebenstragik empfunden, die tapfer ausgehalten wurde. Die späte Flucht in die Liebe einer Studentin ist nicht der schlüpfrige dritte Frühling eines alternden Mannes, sondern Ausdruck einer Sehnsucht. Der Erfolg dieses Buches, das 2006 in den USA nach mehr als 40 Jahren wiederentdeckt wurde und dann in der deutschen Übersetzung von Bernhard Robben auch hier reüssierte, liegt in der behutsamen wie unpathetischen Sprache, die es dem Leser ermöglichte, nicht unter seinem Niveau Mitleid und Empathie zu empfinden. Die Sterbeszene des aufrechten Existentialisten Stoner ist eine der rührendsten der Literatur, wobei es Williams’ Verdienst es, gerade hier keinen süßlichen, melodramatischen Kitsch zu verbreiten.
Der Verlag legt nun mit »Nichts als die Nacht«, John Williams erster Erzählung aus dem Jahr 1948, nach. Der Autor war 26 als dieses Buch veröffentlicht wurde und soll es vier Jahre zuvor schon geschrieben haben. Die deutsche Gattungsbezeichnung ist »Novelle«, was diskutabel wäre, aber eigentlich unwichtig ist. Simon Strauß kommt in seinem Nachwort auf die hinlänglich bekannte Geschichte über Williams’ Abschuss im Indochinakrieg zu sprechen, den dieser nur mit Glück überlebte. Es wäre ein leichtes diese autobiographischen Erlebnisse auf den Text anzuwenden, aber es ist eben auch jene Küchenpsychologie, vor der man sich hüten sollte.