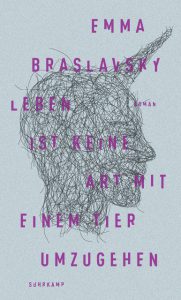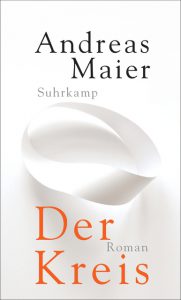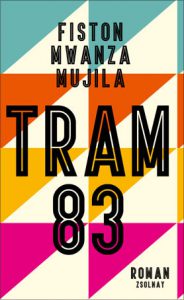
Irgendwo in Afrika, in einem Land, das sich Demokratische Republik Kongo nennt (und vorher Zaire nannte), vielleicht in einer Stadt in der Provinz Katanga, die hier »Stadtland« heisst, einer Stadt oder einem Gebiet, das sich von »Hinterland« abgespalten hat, denn in Stadtland gibt es Steine und diese Steine beinhalten Erze und vor allem Kupfer und das verspricht Reichtum, aber dieses Versprechen gilt nicht für jeden und am Ende kommt es nur noch darauf an, ob man auf der organisierten oder desorganisierten Seite der Bananenrepublik lebt. Dort gibt es das »Tram 83«: Kaschemme, Bar, Imbiss, Jazzclub, Bühne, Tanzpalast, Bordell, Drogenhöhle, Geldwaschanlage, 24 Stunden geöffnet, eine Mischung aus Berghain, Cotton Club, Sodom und Gomorrha, Hieronymus Boschs »Sieben Todsünden« und dem »Weltgericht«, Kirche und Moschee, ein Ort, der fasziniert und abstösst, Treffpunkt für Grubenarbeiter, Studenten, »Touristen«, Dealer, Literaten und Verleger, Frauen, die nach »Küken«, »Single-Mamas« und »Ex-Single-Mamas« und, vor allem, nach Form und Größe ihrer Brüste unterteilt werden, Geschäftsmänner, Zuhälter, Gläubige und Atheisten, Korrupte und Moralisten. Zu Beginn fällt einem noch eine Goldgräberromantik aus den USA ein, aber das wird einem hier schnell ausgetrieben, denn hier herrschen Sex und Geld und ein Frauenüberschuss, da Bürgerkriege noch nicht lange zurückliegen.
Zu Beginn kommt Lucien ins »Tram 83«, ein Schöngeist mit Notizbuch, der ein Bühnen-Epos nach Paris abliefern soll. Er trifft seinen Freund Requiem, genannt »Negus«, einem auf den ersten Blick Kleinkriminellem, der immer unsympathischer wird, sich als Kriegsverbrecher (ein Pleonasmus?), Bandenführer, Plünderer, Vergewaltiger, Erpresser und Schmuggler entpuppt, der Filme mit Jean Gabin und Lino Ventura mag. Irgendwann gibt es noch den Schweizer Verleger Ferdinand, der Gefallen an Luciens Texten findet, aber schließlich von Requiem mit Bildern von ihm und der (minderjährigen) Prostituierten erpresst wird. »Was sagt die Uhr« ist der Standardsatz, den man stellenweise auf fast jeder Seite des Buchs findet. »Was sagt die Uhr« fragt die Meute für die Muße ein Verbrechen ist. Alles ist vulgäres Business (vor allem der Sex), selbst die Kellnerinnen drangsalieren die Gäste zum Trinkgeld und für die Prostituierten gilt die (Schach-)Regel: »berührt-geführt«.