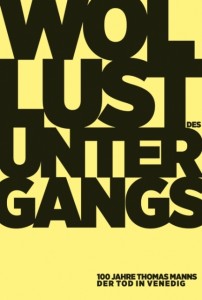Die teilweise heftigen Diskussionen um die jüngste Vergabe des Literaturnobelpreises an Bob Dylan zeigen, dass der Preis immer noch eine gewisse Strahlkraft hat. Ansonsten würden sich die Emotionen nicht derart hochschaukeln. Wenig Beachtung findet dabei, dass die Schwedische Akademie jedes Jahr ein kleines bisschen ihr Archiv öffnet. Mit dem je nach Temperament wohltuenden oder obsolet-hinhaltenden Abstand von 50 Jahren werden die Nominierungen zu den Nobelpreisen veröffentlicht. Das Finden auf der Webseite ist etwas kompliziert. Hat man sich aber erst einmal eingegroovt, wird man mit interessanten Erkenntnissen belohnt.
Derzeit gibt es Zugriff auf die Nominierungslisten zu den Nobelpreisen von 1901 bis 1965. Die Suche kann leicht sowohl über den Namen als auch über das Vergabejahr durchgeführt werden. Insgesamt waren bis dahin 3005 Nominierungen für den Literaturnobelpreis eingegangen. 1901 lagen 37 Nominierungen vor, 1965 waren es bereits 90. (Die Zahl ist inzwischen deutlich höher.) Ein Blick auf die Listen zeigt, dass neben Einzelvorschlägen auch Sammelnominierungen mehrerer Persönlichkeiten für einen Kandidaten gab, die allerdings nur einmal gezählt wurden. Studiert man die Listen genau, so gab es keine Garantie für den »Unterlegenen« bei einer der nächsten Preisvergaben berücksichtigt zu werden.