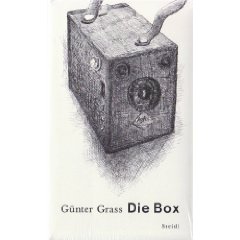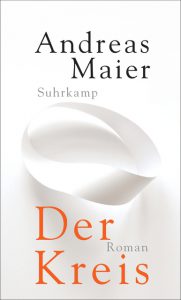
Ich erinnere mich an das erste Buch der sogenannten Wetterau-Chronologie, die bald den Titel »Ortsumgehungen« bekam (oder ohne mein Wissen bereits hatte). Es war der Roman »Das Zimmer« aus dem Jahr 2010, in dem Andreas Maier so leicht und wahrhaftig mehrere Ebenen neben- und schließlich sogar miteinander verschmolz. So verfeinerte er seine kurz zuvor erschienene »Onkel J.«-Erzählung, entwarf fast wie nebenbei eine Kultur‑, Mentalitäts‑, Arbeits- und Lokalgeschichte der Bundesrepublik der 1970er Jahre aus hessischer Regionalperspektive, evozierte Höhepunkte seiner Kindheit und Jugend und stürzte sich schließlich in einer Mischung aus Melancholie und Wut in die Gegenwart und empörte sich über die Verschandelung der Wetterau (und besonders des »Wichsbuschs«) durch allerlei Umgehungs- und sonstige Straßen.
Die weiteren Bände der »Ortsumgehungen« erschienen danach in rascher Folge: 2011 »Das Haus«, 2013 »Die Straße«, 2015 »Der Ort« und nun, 2016 »Der Kreis«. Die einzelnen Bücher bilden keine zeitliche Chronologie, sondern sind locker thematisch sortiert. Nicht nur Ina Hartwig und Jörg Magenau, die scheinbar jeden Band Maiers besprechen, schwelgen regelmäßig in Superlativen. Auch mit einiger Mühe habe ich keine seriöse negative Kritik gefunden (Amazon ausgenommen). Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass Maier fast immer in etwa der Generation der jeweiligen Kritiker angehört; man blickt auf mehr oder weniger den gleichen Ereignishorizont zurück. Und vielleicht waren ja Kindheit und Jugend in einer bürgerlichen Familie in Hamburg oder Frankfurt in den 1970er und 1980er Jahren entgegen der Annahmen nicht wesentlich anders als in der Wetterau-Kleinstadt. Die Identifikationsangebote in Musik, Literatur und Theater waren nicht zuletzt durch die Medien längst universell. In den Elogen auf Maiers Texte ist dem Feuilleton keine Referenz zu groß, kein Vergleich zu gewagt, ob es Proust ist oder Balzac, auch Knausgård, und natürlich Thomas Bernhard, mit dem Maier ja mehr als nur ästhetische Sympathie verbindet (er hat über ihn promoviert).
Der Bezug auf den österreichischen Dichter ist auch hinsichtlich der Kritik Maiers an Bernhards sogenannten autobiographischen Schriften von Interesse. Maier hatte Bernhard vorgeworfen, diese Bücher seien »widersprüchliche Heroisierungen der eigenen Person, ermöglicht durch einen doppelbödigen Umgang mit unserem alltagssprachlichen Wahrheitsbegriff«. Nicht nur den Literaturwissenschaftler Jan Süselbeck hatte dieser Passus verwundert, begeht Maier hier doch so etwas wie einen Anfängerfehler, in dem er Literatur mit Dokumentarismus verwechselt. Selbst wenn der Eindruck einer nachprüfbaren Realität erweckt werden sollte, wird er spätestens durch die Genrebezeichnung »Roman« nivelliert bzw. konterkariert. Fast scheint es so, als sei Maier zornig auf seine eigenen voreilig-fehlerhaften Deutungen der Prosa Bernhards gewesen.