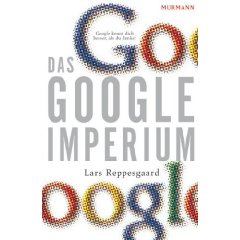Anmerkungen zu einer Handvoll legendärer Sätze
7 – Wir googeln uns blöd!
Digitale Demenz lautet der reißerische Titel eines Buchs, das vor einigen Jahren in Deutschland ein Bestsellererfolg war. Doch der in zwei Worte gefaßte Befund des Gehirnforschers und Psychiaters Manfred Spitzer ist wohlüberlegt und wohlformuliert. Bildschirmmedien hindern die Gehirntätigkeit eher, als daß sie sie fördern: das galt schon für das Fernsehzeitalter, und es gilt erst recht für die digitalen Medien. Das Abnehmen der Leistungsfähigkeit des Gehirns bezeichnet man als »Demenz«; es muß nicht zwangsläufig erst im hohen Alter einsetzen. Eine zweite Bedeutung der Formel bezieht sich auf gesellschaftliche Auswirkungen der inzwischen übermächtigen Digitalkultur. Werden die Bevölkerungen tendenziell immer dümmer? Spitzer zitiert eine Reihe von Studien und Experimenten, die diesen Schluß nahelegen. Insgesamt ist die Schul- und Hochschulbildung im Verlauf des 20. Jahrhunderts in den westlichen Ländern sicher viel breiter geworden. Ob sie – Massenuniversitäten statt Eliteschmieden – auch besser geworden ist, ist eine andere Frage. Wenn es einen Umkehrpunkt gegeben hat, wann genau und weshalb? Die Computer werden nicht allein daran schuld sein.
Spitzers zwanghafte Art, den Eindruck wissenschaftlicher Absicherung zu erwecken, ist eine der Seiten, die an seinen Auftritten kritisiert werden. Jede Menge Statistiken, Korrelationen, aber kein Entfalten von Zusammenhängen. Und pauschale Verurteilungen, ein ums andere Mal wiederholt. Wenig Erzählung, würde ich hinzufügen: Wenig konkrete Beispiele, wenig eigene Erfahrungen. Aber das mag Aufgabe der Literatur sein, also meine. Im großen und ganzen stimme ich Spitzers Einschätzungen zu, auch wenn mir sein hämmernder Stil auf die Nerven geht. Daß wir uns vom digital-medialen Überbau nicht gänzlich befreien können und das folglich auch nicht versuchen sollten, gesteht er selbst zu, allerdings tönt die Konzession viel leiser als seine Unkenrufe. Wir sollten unsere Aufenthaltszeit in der digitalen Welt beschränken, d. h. regulieren (horribile dictu!), manchmal auch längere Pausen einlegen, und vor allem sollten wir eine solche Diät schon unseren Kindern angedeihen lassen. Die vielbeschworenen digitalen Kompetenzen lassen sich nur in Verbindung mit »Vorwissen«, wie Spitzer es nennt, also mit traditionellen geistigen Fähigkeiten, die man nicht am Bildschirm erwirbt, sondern im Kontakt mit der Erfahrungswelt, mit Büchern und mit Erziehungspersonen, sinnvoll ausüben.