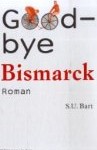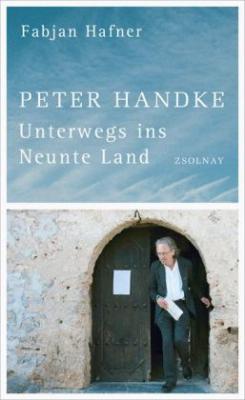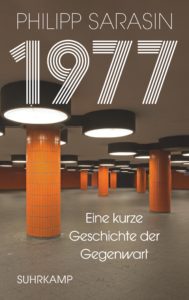
Vor einigen Jahren erschien ein Buch mit dem Titel »1976 – Die DDR in der Krise«. Der Autor Karsten Krampitz erinnerte an Ereignisse, die insgesamt (und rückwirkend) betrachtet eine interessante Tendenz einläuteten. Neben der Ausbürgerung Wolf Biermanns und dem Arrest des Regimekritikers Robert Havemann, die auch im Westen Deutschland ausgiebig rezipiert wurden, waren es auch andere Entwicklungen, wie die Selbstverbrennung des Pastors Oskar Brüsewitz oder die sich in Frankreich, Spanien und insbesondere Italien immer stärkere Rolle der sich parlamentarisch organisierten sogenannten »eurokommunistischen« Parteien, die mit dem Vorrang der sowjetischen KPdSU brachen und damit die SED vor Problemen stellten. Beantwortet wurde dies, in dem Erich Honecker auch noch Staatsratsvorsitzender wurde und nun, wie einst Ulbricht, beide Machtpositionen bekleidete. Krampitz verleitet den Leser mit den Vorgängen des Jahres 1976 inne zu halten und sie in einen historischen Kontext zu stellen. Die Absicht war zwar, die DDR nicht vom Ende her zu denken, aber es ist unweigerlich – und auch der Tenor des Buches – dass sich 1976 erstmals einer breiten Öffentlichkeit zeigte, dass dieser Staat krisenhafte Symptome ausbildete.
Die Versuchung, historische Wendepunkte mit festen Daten zu verknüpfen und damit eine Folgerichtigkeit zu entwickeln, ist verführerisch. So erschien im letzten Jahr von dem Historiker Frank Bösch »Zeitenwende 1979: Als die Welt von heute begann«, in dem weltpolitische Ereignisse des Jahres 1979 als epochen- und zukunftsbildend aufgelistet wurden. Es ist tatsächlich leicht, in diesem Jahr fündig zu werden: Die iranische Revolution, Margaret Thatcher wird britische Premierministerin, der Papst besucht sein Heimatland Polen, die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein, die kommunistischen Sandinisten übernehmen die Macht in Nicaragua, das Camp-David-Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten wurde von der Knesset gebilligt, die Verabschiedung des NATO-Doppelbeschlusses und ein gewisser Deng Xiaoping begann mit der Planung für die ökonomischen Öffnung Chinas.
Mit einer ähnlichen Häufung nachträglich als historisch eingeschätzter Geschehnisse vermag das kürzlich erschienene Buch von Philipp Sarasin, »1977- Eine kurze Geschichte der Gegenwart«, nicht aufzuwarten. Sarasin, der Böschs Buch erwähnt, versucht, die »tiefen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, wissenschaftlichen und technologischen Verschiebungen und Brüche in Westeuropa und den USA, die sich…auf eine erstaunliche Weise im Jahr 1977 bündeln lassen« zu illustrieren. Bereits im Vorwort lässt er sich und dem Leser ein bisschen Leine, in dem er das gesamte Jahrzehnt der 1970er Jahre als »Schwellenjahrzehnt« ausmacht. Wie es im weiteren Verlauf des Buches Usus sein wird, lässt er allen möglichen Befunden freien Lauf, so dass auch Tony Judts – freundlich ausgedrückt – merkwürdiges Urteil zitiert wird, die Siebziger seien das »deprimierendste Jahrzehnt« des 20. Jahrhunderts gewesen.