Um diese Bücher geht es:
Laura Freudenthaler: Arson
Charles Ferdinand Ramuz: Sturz in die Sonne
Roy Jacobsen: Die Unwürdigen
En détail:
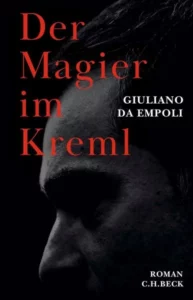
Der Magier im Kreml ist natürlich ein Roman, Geschrieben wurde er vom italo-schweizerischen Autor Giuliano da Empoli (Übersetzung aus dem Französischen von Michaela Meßner). Die einst gebetsmühlenartig vorgebrachte Erklärung, dass Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen rein zufällig seien, ist im Zeitalter des Doku-Dramas längst überholt. Stattdessen wird zu Beginn darauf hingewiesen, dass der Roman auf wahren Begebenheiten und realen Personen basiert, denen »ein Privatleben und erfundene Äußerungen zugeordnet« worden seien. Das war, wenn man sich die Weltliteratur ansieht, einige Jahrhunderte lang nicht ungewöhnlich. Shakespeare tat es mit Richard III., Schiller schrieb Wallenstein Texte zu, die er nicht wissen konnte und immer noch glauben Menschen, dass der Revolutionär Danton so gesprochen hat, wie man in Georg Büchners Stück nachlesen kann. Die Autoren konnten sich darauf verlassen, dass ihr Publikum die Fiktionalität innerhalb des historischen Umfelds verstand – und wenn nicht, war es eher bedeutungslos, weil es damals keine Horden von Schreibern gab, die zwischen Realität und Schriftstellerei nicht unterscheiden konnten.
Der Erzengel des Todes und sein (fiktiver) Berater
Damit der Roman nicht im Korsett der (bisher weitgehend unbekannten und daher eher trivialen) Realität erstickt, hat Empoli die Hauptfigur Wadim Baranow erfunden. Ein nicht näher vorgestellter Ich-Erzähler, der sich in Moskau aufhält, der »unergründlichen Hauptstadt einer neuen Epoche«, ist einerseits fasziniert von diesem geheimnisvollen Baranow, dem vor einiger Zeit demissionierten Berater des »Zaren« Wladimir Putin. Und er ist besessen von Jewgeni Samjatin, einem russischen Schiffbauingenieur und Schriftsteller (1884–1937), der in den 1920er Jahren den dystopischen Roman Wir verfasste und damit bei Stalin in Ungnade fiel. Es gibt in Empolis Roman, vage Interessenten an einer Neuauflage von Wir sowie einer Verfilmung, was als Ursache für den Aufenthalt genommen wird. Wann der Roman spielt bleibt unklar; es ist diffus vom Ukraine-Krieg in der Vergangenheit die Rede. So recht kommt der Erzähler nicht voran; er pflegt sein Außenseitertum obwohl (oder gerade weil?) er als Ausländer einer ständigen Überwachung zu unterliegen scheint (die Begleiter nennt er »Briefmarken«).
In den sozialen Netzwerken entdeckt er einen gewissen Nicolas Brandeis. Der Name erinnert an eine Figur aus einem Joseph-Roth-Roman und ist vor allem das Pseudonym, unter dem Baranow einst Essays, Aufsätze und ein Theaterstück veröffentlicht hatte. Brandeis’ Postings sind eher selten und meist geheimnisvoll. Ist es Baranow oder einfach nur irgendein Student, der das Pseudonym angenommen hat? Als Brandeis einen Satz aus Wir postet, wird er hellhörig. Er antwortet dem unbekannten Nutzer ebenfalls mit einem Zitat und rasch steht der Reporter in Baranows für russische Verhältnisse luxuriösen Anwesen außerhalb von Moskau.
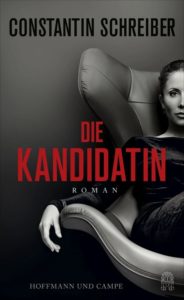
Irgendwann, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, in Deutschland: Eine muslimische Kandidatin der »Ökologischen Partei« hat große Chancen, Bundeskanzlerin zu werden. Es ist Wahlabend. Sie will zu ihren Anhängern sprechen. Die skandieren ihren Wunsch nach der »totalen Diversität«. Und dann werden die letzten drei Monate rekapituliert.
Natürlich fällt einem rasch Michel Houellebeqs »Unterwerfung« von 2015 ein, in dem ein muslimischer Präsident gewählt wird und nicht zuletzt mit arabischem Geld eine »freundliche Übernahme« des institutionellen Frankreich erreicht. Constantin Schreibers »Die Kandidatin« nimmt durchaus Anleihen an dieses Arrangement, aber es ist doch ein ganz anderer Roman.
Der Verlag nennt das Jahr 2041, in dem das Geschehen angesiedelt sein soll. Einige Angaben im Buch legen nahe, dass das nicht sein kann. Wie auch immer: Marine Le Pen ist Präsidentin in Frankreich und der greise Xi Jinping steuert immer noch die Geschicke Chinas. Er ist soeben mit seiner Armee in Taiwan einmarschiert und hat die Insel annektiert. Auch Wladimir Putin ist noch Präsident und bedroht (wie schon immer) die Ukraine. Der Nahe Osten (außer Israel) droht zu »implodieren«. Aber Saudi Arabien hat die Atombombe. Die USA kommt nur als Ort von Rassenunruhen vor. Die EU ist praktisch am Ende. Der Euro existiert noch, aber »stetig fallende Negativzinsen führten dazu, dass sowohl Guthaben als auch Schulden immer weniger wert wurden« und »Gold und Aktien…zur Parallelwährung« wurden. China erpresst die Europäer mit seinen Euroanleihen. Hier ist die neue Supermacht.
Deutschland wird von einer Bundeskanzlerin regiert. Sie wird nur als Funktionsträgerin erwähnt; die Person bleibt diffus, wie die Regierung zusammengesetzt ist, erfährt man nicht. Der Innenminister ist ein Förderer von Sabah Hussein, für die er »den Posten der Sonderbeauftragten für öffentliche Dialoge« schuf – weniger aus Überzeugung als aus Karrieregründen, um nicht von Menschen und Organisationen mit »Vielfaltsmerkmalen« angegriffen zu werden. Hussein ist 44, sieht aber jünger aus. Den Hijab hatte sie nach Konsultation mit »ihrem« Imam mit Eintritt in die Politik abgelegt, aber in einer bundesweiten Aktion das Tragen des Hijab als feministisch-emanzipatorische Geste für junge Muslima geframt. Sie selber kleidet sich modisch, auffallend, während »von zahlreichen progressiven Frauen und Männern und Diversen« ganz selbstverständlich der »einfarbige Genderkaftan« getragen wird, »der jegliche Körperformen neutral verhüllt« (ergänzend dazu die »Unisexboots ‘Birkendocs‘«).
Alle sind eingeschlossen. Die Türen bekommt man nicht mehr auf. Alle zwei Tage gibt es Lebensmittelrationen bzw. das, was man als Lebensmittel deklariert. Der Grund ist ein marodierendes Todesvirus. Die zweite, dritte, werweißwievielte Welle. Da ist von der »großen Internierung« die Rede, dem Kontrollieren, den Videokameras. Durchsagen prasseln in den öffentlichen Raum, »Ermahnung und Ermunterung«, ...
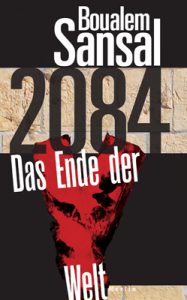
Wenn Gesellschaften – aus welchen Gründen auch immer – trotz eines exorbitanten Wohlstands mit einem diffusen Unbehagen der Zukunft entgegen sehen, weil sie vor Umbrüchen mit unsicherem Ausgang stehen, dann ist Zeit für dystopische Romane, die dann die eher harmlos daherkommende (leider zu oft banale) Fantasy oder bewusst technikaffine Science-Fiction-Seligkeit überwuchern. Nicht zuletzt in der aktuellen deutschsprachigen Literatur gibt es einen Trend zur Dystopie, vielleicht auch einfach nur, weil es im Alltag so gar keine Abenteuer mehr zu erleben gibt.
Bei Boualem Sansal sieht dies anders aus. Der 1950 in Algerien geborene Autor fand erst spät zum literarischen Schreiben, avancierte aber schnell zum bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller seines Landes und bekam 2011 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Jetzt hat er mit »2084 – Das Ende der Welt« einen Weltuntergangsroman geschrieben. Das Buch war zunächst in Algerien nicht zu erhalten und sorgte für Diskussionen in Frankreich. Seit Mai liegt es auch in einer deutschen Übersetzung von Vincent von Wroblewsky vor.
Das deutsche Feuilleton befragt Sansal ausgiebig, aber noch mehr möchte man über seine Einschätzungen zur aktuellen politische Lage wissen, den Bedrohungen durch das, was man gemeinhin »Islamismus« nennt. Sansal hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Er bezichtigt besonders die westliche Linke als naiv im Umgang mit dem politischen Islam, was diese zum Anlass nimmt, ihn in eine neurechte Ecke zu stellen; das inzwischen bekannte Gesellschaftsspiel. Die Erfahrungen, die Sansal in Algerien macht und gemacht hat, werden hierbei gerne heruntergespielt. Die Politisierung eines solchen Romans hat allerdings meist zur Folge, dass die Diskussion weniger um das Buch als um die politischen Thesen des Autors kreist. Dies erzeugt Erwartungshaltungen, die je nach Orientierung enttäuscht oder bestätigt werden. Dabei tritt dann die literarische Qualität eines solchen Buches allzu oft in den Hintergrund.