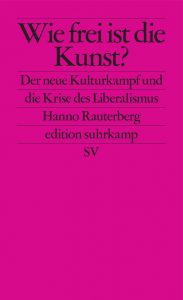Es gehört zur raison d’être eines Schriftstellers, auf die Sprache zu achten. Die allgemein im Gebrauch stehende ebenso wie seine persönliche Sprache liegt ihm am Herzen. Zumindest mir geht es so, ich will die Sprache nicht zerstören (wie einst einige Dadaisten) oder verwahrlosen sehen, ich will sie erweitern, aus ihren Möglichkeiten schöpfen, sie notfalls auch schützen. Wohl deshalb bin ich empfindlich, wenn aus ideologischen oder bürokratischen Erwägungen an ihr gemäkelt, gezerrt und gerüttelt wird.
»Sprecher*innen« und »Schreiber*innen« würde ich schreiben, wollte ich mich politisch-moralisch korrekt verhalten. Oder »Sprechende und Schreibende«. Beides nicht schön. Zu diesem Thema ist schon viel Tinte geflossen, ich will nicht mehr als ein paar Tropfen hinzuzufügen, die deutsche und die romanischen Sprachen betreffend vor allem den Hinweis, dass in sogenannter inklusiver Sprache auch die Artikel und Adjektive synchronisiert und im Genus-Bezug pluralisiert werden müssten, was oft unterbleibt oder inkonsequent durchgeführt wird. Wenn aber strikt synchronisiert wird, steigt in manchen Wortfolgen die Umständlichkeit der Äußerung noch einmal an. Kürzlich war ich bei einem Seminar literarischer Übersetzer. Der Großteil der Teilnehmer weiblich, die Vortragenden weiblich, abgesehen vom jungen Einführungsredner. Er begann mit dem Satz: »Ich bin kein studierter Literaturwissenschaftler…in.« Das Suffix kam erst nach einer kurzen Pause, das Adjektiv und die Negation hätte er eigentlich anpassen müssen, was im Mündlichen schwierig ist, aber auch schriftlich: »kein*e studierte*r Literaturwissenschaftler*in«, oder was immer man an Schriftzeichen aufbieten will.
Ich habe fast täglich mit Texten in fünf bis sechs Sprachen Umgang. Die genderbewussten Änderungswellen fallen mir in den meisten von ihnen auf; in einigen, bedingt durch die Struktur der Sprache, mehr, in anderen weniger. Besonders störend und destruktiv empfinde ich derlei Änderungen im Französischen und im Spanischen. Im Französischen kommen sie mir nur in der Online-Zeitung Mediapart unter, dort aber so massiv, dass die Lesbarkeit der Artikel immer wieder in Gefahr steht. Le Monde, sprachlich konservativ, brachte letztes Jahr einen Bericht über einen Gesetzesvorschlag des französischen Senats, sogenannte »inklusive Sprache« in offiziellen Dokumenten zu verbieten. Der Artikel begann leicht ironisch mit der Bemerkung, man könne an dieser Stelle von »sénateurs« und »sénatrices« sprechen, aber nicht von »sénateurices« – wobei die konsequente inklusive Schreibweise eigentlich »sénat(eur)ices« lauten müsste. Der Senat möchte nicht zuletzt sogenannte non-binäre, in Wörterbüchern bisher nicht enthaltene Formen wie das pronominale »iel« (Verbindung von »il« und »elle«), »celleux« oder »toustes« verbannen, die für mein Ohr tatsächlich grotesk klingen. Das Bildungsministerium hatte schon 2021 einen Erlass ausgesandt, der solchen Sprachgebrauch an Schulen untersagt.
Aber vor solchen Grotesken scheuen die Ideolog*innen nicht zurück. In Spanien und noch mehr in einigen lateinamerikanischen Ländern prägen sie Formen wie »todes«, um Personen zu inkludieren, die sich weder als männliche »todos« noch als weibliche »todas« erkennen können. Das ergibt dann Formen wie »chiques« für non-binäre Jungs/Mädels/X (auch das X kommt mittlerweile zu grammatischen Ehren), sodass man sich im Plural nicht nur an »querido.a.s chico.a.s« wenden wird, sondern auch an »querides chiques«, am besten vielleicht so: »querido.a.e.s chic(qu).a.e.s«. Dass sich so etwas dann nicht mehr lesen lässt, verstehen wohl auch jene Leser, die des Spanischen nicht mächtig sind. In Argentinien versucht die Regierung von Staatspräsident Javier Milei inzwischen, inklusive Sprache in den Ämtern zu verbieten; dasselbe tut seit letztem Jahr die Landesregierung in Niederösterreich. Zwischen Konservativen und Progressiven ist in vielen Teilen der Welt ein Ping-Pong-Kampf um die Sprache im Gang. Der Schriftsteller steht am Netz und bewegt den Kopf hin und her. Schreiben wird er weiterhin so, wie er es für gut hält. Wenn ihm nicht sensitive Lektor*innen im Verlag dicke Striche ins Manuskript setzen.