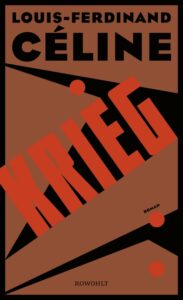
Im August 2021 erfuhr die Öffentlichkeit von bisher verborgenen, rund 6000 Manuskriptseiten des 1961 verstorbenen französischen Schriftstellers Louis-Ferdinand Céline. Hatte der Autor nicht immer behauptet, die Manuskripte seien zerstört oder gestohlen worden? Nach Prüfung auf Echtheit steht nun fest, dass es sich streng genommen nicht um eine Entdeckung, sondern eine Enthüllung handelte. Den Weg dieses Konvoluts zeichnet Niklas Bender in seinem instruktiven Vorwort zu Krieg nach, dem ersten, ins Deutsche übersetzten Text dieses Manuskriptbündels.
Der Roman wird in einer populären und damit lesbaren Version präsentiert. Die zahlreichen Korrekturen des Autors, von denen einige im Buch abgedruckten faksimilierten Seiten einen Eindruck geben, sind nicht aufgeführt worden. Für das unmittelbare Verständnis wichtige Ergänzungen (beispielsweise Célines Wortspiele bei Stadt- und Personennamen) findet man in präzise gesetzten Fußnoten. Die Übersetzung ist glücklicherweise von Hinrich Schmidt-Henkel, der schon mehrere Bücher von Céline, darunter auch die Reise ans der Ende der Nacht ins Deutsche übertragen hatte (und, »nebenbei«, auch der Übersetzer des aktuellen Nobelpreisträgers Jon Fosse ist).
Wer ein bisschen über Céline weiß, sollte mit dem eigentlichen Text beginnen und das Vorwort danach lesen. Die ersten zehn Seiten des Manuskripts scheinen tatsächlich verloren zu sein. Die Übertragung beginnt mit Seite 10. Ferdinand, ein schwer verwundeter, umherirrender Ich-Erzähler, orientiert sich im Januar 1915 von der Front zurück ins Hinterland. Er sieht aufgeplatzte Menschen und aufgeschlitzte Pferde und hat »grauenhafte Schmerzen«. Zum einen ist ein Arm schwer verletzt (er hängt, wie es einmal heißt, »in Fetzen«). Und zum anderen steckt eine Kugel in seinem Kopf, in der Nähe des Ohrs. »Der Krieg hat mich im Kopf erwischt. Er ist in meinem Kopf eingesperrt.« Er hört permanent eine »Geräuschsuppe«, »Getöse«, »Ohrgedonner«; dies wird ihn bis zum Ende nicht verlassen. Nach vielen Irrungen landet er in einem Lazarett im fiktiven Ort »Peurdu-sur-la-Lys« (Wortspiel aus »peur« für Angst und »perdu« für verloren). Halluzination und Realität sind nur schwer zu unterscheiden; Ferdinand vermischt alles. Der Text konzentriert sich zunächst auf eine Krankenschwester, die ihn mal masturbiert, dann katheterisiert, dann beides. Sie wird, so die Erzählung, zu einer Fürsprecherin, gar Geliebten. Zwar wird der Arm operiert, aber das der scheinbar wenig routinierte Arzt die Kugel aus dem Kopf entfernt, verhindert sie. Die Bekanntschaften unter den eingelieferten Patienten wechseln – die meisten sterben weg. Länger hält eine Art Freundschaft zu einem gewissen Bébert, der mit einer Schußwunde im Fuß eingeliefert wurde und merkwürdigerweise auf eine Amputation drängt. (Die Vorläufigkeit des Manuskripts bedingt, dass Bébert im Laufe des Romans Cascade heißt und auch sonst die Figuren manchmal unterschiedliche Namen tragen; es stört wenig.)
