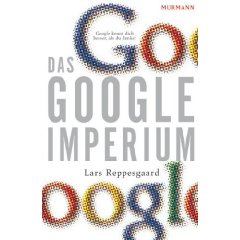
Zunächst einmal ist es ziemlich wohltuend, dass sich jemand dem Phänomen Google nicht mit der üblichen, dämonisierenden Aufgeregtheit nähert, sondern einen eher nüchternen Ton anschlägt. Andererseits scheint es nicht ganz einfach zu sein, über einen Konzern zu berichten, der sich in bestimmten Bereichen extrem zurückhaltend mit Informationen verhält. So stachelt man einerseits nur noch mehr die Neugier an, dokumentiert aber andererseits indirekt die Fragilität eines Unternehmens, welches zwar aus nachvollziehbaren Gründen beispielsweise Art und Standort ihrer Rechner oder Details über den Such-Algorithmus ihrer Suchmaschine streng unter Verschluss hält, letztlich aber auch aus der Verwendung ihrer mindestens theoretisch möglichen Datenpakete, die sie von Usern gesammelt hat, nicht offenlegt.
Diese Fragen wirft Lars Reppesgaard in seinem Buch »Das Google-Imperium« zwar durchaus auf, aber derartige kritische Ansätze sind gut verborgen im Teig einer idyllischen Unternehmensprosa, die beispielsweise den Google-Arbeitsplatz als eine Mischung aus possierlichen Nerdtum, kuschelige[r] Programmierbutze, hochkonzentrierter und doch immer auch experimenteller Versuch und Irrtum-Tüftelei und universitär-elitärer Informatikwissenschaft darstellt. Hier arbeiten nur Genies. Da bastelt Reppesgaard ganz schön am Image des genialischen Nonkonformistentums, mit dem sich Google auch heute noch gerne parfümiert.
