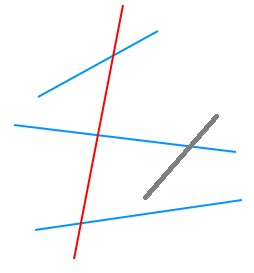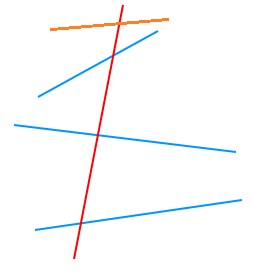Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Herzklappen von Johnson & Johnson von Valerie Fritsch: ein Buch, das ich gern mögen und als »neuartig« hervorheben würde. Ganz ohne Dialoge, auch ohne innere Monologe, ganz geschriebene Sprache, gefeilt und ausgefeilt, deshalb immer (nur?) schön. Andererseits ist die Geschichte fragwürdig, sie wird vernachlässigt, unernst erzählt. Der Großvater im Krieg als Mörder, wirklich? Alle diese latent oder auch manifest vorwurfsvollen Kriegsgeschichten, aufgespürt und ausgegraben von Enkeln und Urenkeln, die von der Geschichte, die sich ihnen verweigert, betroffen sein wollen. Jeder Soldat ein Mörder? Ja, sicher, aber das müßte man dann konsequent so schreiben und nicht den einen Großvater anklagen. Soldaten sind Mörder, von den Vorgesetzten und letztlich vom Staat zum Mord verpflichtet. Weigern sie sich zu töten, werden sie selbst getötet.
Und die Mutter der Erzählerin ist auch was Besonderes, nämlich Schlafwandlerin. Der Vater kommt fast gar nicht vor, vielleicht zu normal? Die Kapitel setzen die Figuren kaum miteinander in Beziehung, vielmehr widmet sich jedes jeweils einer Figur, der Reihe nach, wie Wäsche auf der Leine. Und dann bleiben sie mehr oder weniger aus dem Buch fort. Einfacher gesagt: Die Geschichte ist nicht durchgehalten. Auch der Liebhaber der Erzählerin und spätere Ehemann bleicht aus. Und der schmerzunempfindliche Emil. Gibt es das überhaupt, Menschen, die gar keinen Schmerz empfinden? Anscheinend ja, sehr selten. Analgesie heißt das. Laut Wikipedia sind bisher dreißig davon betroffene Personen bekannt. Dreißig weltweit, oder wo? Steht nicht in dem Artikel. Nach der Lektüre des Buchs kann ich mir diesen Zustand nicht vorstellen. Keine Bodenhaftung, die Erzählerin stellt sie nicht her.
Vögel schauen zum Fenster herein, und die Menschen schauen hinaus. Die Vögel wohnen draußen, deshalb schauen sie manchmal herein; die wohnen herinnen, deshalb schauen sie hinaus. Nein, die Vögel fliegen sofort weg, wenn sie sehen, daß sich etwas bewegt. Aber das Bild von den hereinschauenden Vögeln ist hübsch. Die Gefährdung Emils, des Schmerzunempfindlichen, wird eine Zeitlang ausgiebig beschrieben, dann kommt es zu einer Autoreise nach Kasachstan, die mehrere Wochen dauert, das alles kursorisch erzählt, zusammenfassend, porträthaft umgreifend. Aber, Frage des Lesers mit seiner Wirklichkeitssorge: Ist das nicht völlig verantwortungslos, auf einer Reise in ein fernes Land, nahe an Kriegsgebieten, wo keine ärztliche Versorgung zu erwarten ist – ist es nicht gefährlich, ja, verantwortungslos, ein solcherart gefährdetes Kind mitzunehmen? Einen Analgesiker! Die Frage platzt aus dem Realitätsbewußtsein in die Fiktion herein. Die Schreiberin stellt sie nicht (mehr). Und die Teile der Geschichte greifen nicht (mehr) ineinander.
Dieses Buch bietet eine Variante des Um-jeden-Preis-originell-sein-Müssens. Diese besonders außergewöhnlichen Figuren, mit besonders geschärften oder auch, andersrum, fehlenden Sinnen. Varianten der Bemühtheit. Und dann verebbt der Schwung, reicht nicht aus bis zum Schluß. Keine Dramatik. Angenehmes Dahinschnurren der Erzählungen, man liest sie gern. Wenn man sich nicht gerade über ein Detail ärgert, ein, zwei Mal pro Seite. Dahinschnurren – Ärgern – Dahinschnurren – Ärgern…