»Das Schweigen, das tiefe Verschweigen, besonders wenn es Tote meint, ist letztlich ein Vakuum, das das Leben irgendwann von selbst mit Wahrheit füllt.« So beginnt Ralf Rothmann seinen Roman »Im Frühling sterben«. Man sieht vor seinem geistigen Auge förmlich den prätentiösen Ausdruck des Dichters oder Vorlesers, der bedeutungsschwere Duktus, der den Leser, die Leserin, auf diese Literatur vorbereiten soll und unumwunden signalisiert: Hier entsteht etwas ganz Besonderes, ein Meisterwerk. Das Schweigen, »wenn es Tote meint«, füllt das Leben mit »Wahrheit«. Fragen, wessen Leben mit Wahrheit gefüllt werden soll und wie dies mit dem »tiefen Verschweigen« gemeint sein könnte, wirken da eher störend, nach dem Sinn dieses Satzes zu suchen erst recht.
Sechseinhalb Seiten skizziert ein Ich-Erzähler mit starken Strichen das Leben seines Vaters Walter Urban. Das schweigsame Wesen, seine Hilfsbereitschaft (»das Wort hochanständig fiel oft«), die Jacken von C & A, die er gerne trug. 30 Jahre arbeitete er als Hauer im Bergwerk in Essen, ohne Gehörschutz. Er ertaubte und verstand nur noch seine Frau, »ob es ihre Stimmfrequenz war oder die Art der Lippenbewegung« weiß der Erzähler nicht. Nach der Frühverrentung, die ihn kränkte, war das Leben praktisch schon zu Ende. Es gab die Zeitung, Heftchenromane und, leider, den Alkohol. Schließlich der Krebs mit 60, das war 1987. Der Erzähler schenkt ihm ein Heft, in dem er etwas vom Krieg, von seinem Leben aufschreiben soll, aber außer ein paar Ortsnamen schreibt Walter Urban nichts hinein. Der Schriftsteller sei doch er, bemerkt er spitzbübisch. Auf dem Sterbebett beginnt er im Schlaf zu sprechen. Er sei jetzt »wieder im Krieg« sagt dann seine Frau.
Und dann, auf Seite 13, beginnt eine Geschichte von Walter Urban ab Februar 1945. Er ist Melkerlehrling in Norddeutschland, der Prügel-Vater im Feld irgendwo auf dem Balkan (strafversetzt, weil er Gefangenen Zigaretten gegeben haben soll), die Mutter mit seiner Schwester in Essen. Es ist Sonntag und es gibt ein Fest. Der »Reichsnährstand« gibt einen aus. Man trifft sich im »Fährhof«, die Kapelle, die aus Kriegsversehrten besteht, spielt Hans Albers, Zarah Leander und Heinz Rühmann. Irgendwo steht auch ein SS-Mann mit der Aufschrift »Frundsberg« – schöner Gruss von Rothmann an Günter Grass.
Walter trifft den wilden Fiete, der auch auf dem Hof als Lehrling arbeitet (man nennt die beiden Ata und Imi, weil sie so gründlich sind), seine Flamme Elisabeth und Fietes Verlobte Ortrud. Alles ist wunderbar, die Cordhose sitzt, das Bier schmeckt. Ein entstellter SS-Offizier, Ritterkreuzträger, erzählt von seinen Heldentaten, »zaghafter Applaus« im Publikum. Und dann die Rede eines Funktionärs vom »Reichsnährstand«, der in einer kruden Rekrutierungsaktion mündet, die man schon leicht abgewandelt in Heinz Reins 1947 erschienenem, fulminanten Buch »Finale Berlin« findet. Der Funktionär »schlägt vor«, dass jeder Mann auf diesem Fest schon am nächsten Tag freiwillig in die »siegreiche Waffen-SS« eintreten soll. » ‘Wer dagegen ist, kann ja jetzt aufstehen.’ « Stille im Raum. Fiete will aufstehen, Walter hält ihn aber zurück. »Fernbleiben ist Desertion« heißt es sicherheitshalber beim Offizier am Tresen. Und schon sind alle ab Montag 7 Uhr früh in der Waffen-SS.
Es folgen auf rund 180 Seiten die Erlebnisse Walter Urbans. Die Grundausbildung dauert nicht drei Monate, sondern drei Wochen. Die Zeit reicht, um den Führerschein zu machen und Walter wird Fahrer. Binnen weniger Tage ist die Einheit in Ungarn. Der Erzähler beobachtet Walter wie ein Berichterstatter. Es gibt elegische Schilderungen von Landschaften, ekelerregende aus Lazaretten, fürchterliche von menschenverachtenden SS-Schergen, die willkürlich ernannte Partisanen aufhängen. Nur eines gibt es nicht: Eine Innenperspektive der Figur Walter Urban. Sie bleibt für die Zeitgenossen und für den Leser unnahbar, öffnet sich nicht und es werden keine Anstalten gemacht, dies zu ändern.
In einer kühnen Aktion, die ihm ungeplant passiert, befreit Walter eingeschlossene Kameraden. Eine Auszeichnung hierfür lehnt er ab und erwirkt beim Kommandeur (Marke guter, netter Hauptsturmführer) die Erlaubnis, das Grab seines Vaters, der zwischenzeitlich in der Nähe von Györ gefallen sein soll, zu suchen. In Anbetracht der im März 1945 grassierenden Treibstoffknappheit ist die Erlaubnis zu diesem Dreitagesausflug ziemlich unwahrscheinlich, aber Rothmann braucht das wohl um die Zerstörungen der Landschaft, die Verrohung der Soldaten und die Aussichtslosigkeit des Unterfangens bei gleichzeitigem Weitermachen Aller zu illustrieren. Als er nach vergeblicher Suche zum vereinbarten Ort eintrifft (obwohl ihm ein Treibstoffkanister gestohlen wird) sitzt Fiete in der Todeszelle, weil er nach seiner halbwegs überstandenen Verwundung sofort wieder eingesetzt werden sollte und deshalb desertieren wollte. Walter will intervenieren, aber der »gute« Hauptsturmführer ist tot. Hier entsteht die gelungenste Szene im Buch. Walter setzt sich beim neuen Kommandanten Domberg für Fietes Begnadigung ein. Die Figur Domberg, der in Walters fehlendem Genitiv fast den Untergang der Jugend herbeibeschwört und en passant den Beruf des Melkers für obsolet erklärt, weil demnächst alles von Maschinen gemacht würde, ist in der Schilderung der freundlichen Brutalität, die viel unerwarteter daherkommt als die kruden Methoden anderer SS-Leute und dadurch noch abscheulicher wirkt, sehr gut gelungen.
Am Morgen wird dann »die Stube« abkommandiert, Fiete zu erschießen. Also auch Walter. Warum Fiete plötzlich zu Walters Stube zählt, ist nicht ganz deutlich, denn zwischenzeitlich waren sie in anderen Einheiten. Einer der Schützen hat eine Platzpatrone – das ist der Trost. Selbst Danebenschießen traut man sich nicht. Es ist Walters einziger Schuss in diesem Krieg. Nach dem Tod Fietes am 30. März 1945 könnte der Roman eigentlich zu Ende sein, aber es geht dann nach dem Krieg noch nach Essen zu Walters Mutter, die er sofort wieder verlässt. In Kiel trifft er Elisabeth und diese folgt ihm dann in die Landwirtschaft (bis sich Dombergs Diktum dann bewahrheitet).
Es gibt noch einen Epilog, in dem der Ich-Erzähler zum Grab seiner Eltern fährt. Die Pachtzeit ist abgelaufen und er überlegt, ob er sie verlängern soll. Die Entscheidung möchte er am Grab treffen. Es schneit, er kauft Blumen, aber er findet die Grabstätte nicht mehr. Dann ist das Buch aus.
Und das Feuilleton jubelt.
Aber warum? Ist es die Coolness des Helden, der Clint-Eastwood-mässig die Schrecken seiner Eindrücke in sich vergräbt? Etwas, das viele dieses 27er-Jahrgangs gemacht haben und, was man viel intensiver und eindringlicher bald in Jan Koneffkes »Ein Sonntagskind« wird nachlesen können. Sind es die sogenannten »poetischen« Stellen, die derartige Verzückungen auslösen? Etwa die »langen Schatten« der Wimpern der ungarischen Steppenrinder? Oder als Walter auf der Suche nach dem Grab seines Vaters an einen mysteriösen Platz kommt und es heißt: »Die Abendsonne füllte die herumliegenden Helme mit Schatten.«? Vielleicht ist es ja »poetisch«, wenn ein Blitzmädel Walter mit ihren »milchblauen« Augen anschaut? Am Morgen, als Fiete exekutiert wird, »musterte« ein alter Keiler »die Tannen am anderen Ufer aus schmalen Augen, ehe er sich hinabbeugte und die Entengrütze schlürfte« und der »Pürzel kreiselte vor Behagen« (es ist wohl ein »Bürzel« gemeint, aber egal). Als Walter mit den anderen für die Exekution seines besten Freundes den Stahlhelm aufsetzen muss, fühlt er dessen kaltes »Metall« nicht etwa auf dem Kopf, sondern auf dem Scheitel.
Statt Poesie sehe ich vor allem eine gehörige Portion Edelkitsch, garniert mit schwülstig-klebrigen Manierismen. Anlässlich eines Films von Hans-Jürgen Syberberg über Adolf Hitler sprach Saul Friedländer in »Kitsch und Tod« 1984 von »wollüstiger Beklemmung und hinreißenden Bildern«, die »man unentwegt weitersehen will«. Genau diese Faszination wird in diesem Buch befeuert.
Weil die Emotionen Walters nicht erkennbar sind – weder von ihm noch vom Erzähler vermittelt – flüchtet sich Rothmann in Umgebungsbeschreibungen um eine kontrastierende Stimmung zu evozieren, die indirekt auf Walters Gefühlshaltung hinweisen soll. Dies mag in den Ruhrgebiets-Romanen Rothmanns gelingen, denn die Lebenswirklichkeit des Erzählers korrespondierte hier mit der der Figuren. Im vorliegenden Roman ist dies jedoch nicht der Fall: Rothmann ist 1953 geboren. Das bedeutet nicht, dass man als Nachgeborener nicht über solche Figuren erzählen kann (im bereits erwähnten Buch von Jan Koneffke zeigt sich, dass dies möglich ist). Aber indem die Figur derart emotionslos sozusagen »abgefilmt« wird, entsteht nur das eindimensionale Kulissenbild eines behaupteten Geschehens; Walter Urbans scheinbare Beherrschtheit wirkt fast schon arrogant. Lediglich die Exekutionsgeschichte durchbricht diese erzählerische Schwäche, weil der Leser sofort Partei für die wesentlich farbiger erzählte Figur Fiete entwickelt. Genau hier findet sich dann auch die einzig erkennbare halbwegs als Emotion zu deutende Stelle bei Walter, als der Schuss, den er auf den Freund abgibt »ein Reflex mehr als die Ausführung eines Befehls« bezeichnet wird.
Noch aus einem anderen Grund ist »im Frühling sterben« problematisch: In dem der Ich-Erzähler suggeriert, von seinem Vater kaum signifikantes über den Krieg erfahren zu haben und dann doch eine derartige Geschichte ausgebreitet wird, wird der Eindruck der Authentizität vermittelt. Indem er die Schilderungen des Lebens und kurzen Sterbens des Vaters an den Anfang stellt, wird ein Eindruck erzeugt, dass ab Seite 13 nun die reale Lebensgeschichte des Vaters beginnt. Der Erzählduktus verstärkt diesen Eindruck noch. Ohne diesen Kniff wäre die Betroffenheit des Lesers geringer, da durch den Prolog bereits eine Identifikation mit Walter geschaffen wurde (und sei es Mitleid).
Der Enthusiasmus, der diesem Buch landesweit in den Feuilletons entgegengebracht wird, ist von dessen Text her allein jedenfalls nicht nachvollziehbar.
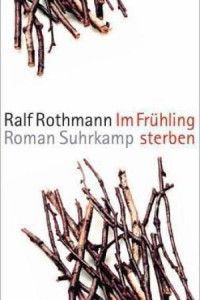
Operation gelungen. Kitsch abgekratzt. Patient lebt: Der Wunsch, verfilmbare Literatur heute mit leisem Ich-bin-Deutschland zu suggerieren.
Ja, so klingt es – sowohl aus der Besprechung als auch wie Brinkemper es auf den Punkt bringt.
Und ich war so neugierig auf das Buch!
Dass gerade Rothmann, dazu mit einem derart persönlichen, ach was: intimen Bezug (um „Betroffenheit“ zu vermeiden), mal etwas anderes aus einem solchen Thema macht … die Üblichkeiten vermeidend, durch eine überraschende Perspektive, durch mehr Nachdenken / Tiefenschärfe / Präzision ... mit mehr Durcharbeitung eben etwas von Rothmann.
Ich bin verunsichert – werde es aber wohl trotzdem lesen.
(Vielleicht in dem Zusammenhang albern aber … mir fiel auf, dass ich ihn, der bisher nie in solchen Buch-Promotions-Berichten auftauchte, es auf einmal tat, arg brav den Text darstellerisch auch noch mit einem Gang auf den Friedhof illustrierend! Oh Gott!)
(Oder habe ich da, der zwar sehr selektiv kuckt aber doch meint, das Entscheidende mitzukriegen, über die Jahre etwas übersehen? Rothmanns unbedarftes Verlags-Solidaritäts-Statement damals in der Barlach-Sache hatte ihn für mich schon blamiert. Wird er am Ende ein ganz normaler Schriftsteller? [Polemik / Ende])
@en-passant
Lesen Sie das Buch unbedingt und schreiben dann – vielleicht, wenn Sie mögen – ob meine Vorbehalte zutreffen oder nur Idiosynkrasien sind. Oder Reflexe, die mich veranlassen nach einem solchen Jubel umso skeptischer, genauer und auch womöglich (?) ungerechter zu lesen...
PS: Die Verfilmung habe ich auch schon wirklich vor Augen. Produktion vermutlich Nico Hofmann oder Oliver Berben oder beide. Keilerdressur Dirk Steffens.
Mir hat sich beim Lesen der Eindruck aufgedrängt, dass dieses Buch mit speziell dieser Geschichte eines Späteingezogenen kurz vor Kriegsende etwas ganz Besonderes sein will, es wirkt auf mich sehr ambitioniert in seiner Durchdachtheit der Geschichte (Filmplot wurde ja schon angesprochen, Machart »Unsere Mütter, unsere Väter« etc) aber das geht einfach nicht auf. Dafür dass dieses Buch so kurz gehalten ist, erscheint die Sprache, mit der hier erzählt wird, nachlässig und stellenweise lustlos, z.B. bei der Ermordung der Müllersleute heisst es in einem fort: »Doch der beachtete ihn nicht;...«, »Doch als das Zittern seiner Frau plötzlich so stark wurde...«, »...doch Walter blieb im Scheunentor stehen...«, »Doch dann griff das Seil«, »Doch Fredo wollte nicht sterben […]«, »Doch dann hörte er sie leise rufen...« usw. Puh!
Zum anderen ist es so, dass Rothmann an zwei Stellen ein regelrechter Sprachschluder unterläuft: »Dabei sagte er etwas nah an ihrem Ohr, und als Elisabeth lachte, fiel Walter einmal mehr auf, dass sie eigentlich nicht schön war.« und gegen Ende des Buches: »Laternenlicht schien durch die Korridorfenster, man konnte in die Klassenräume sehen, wo die Schatten der Flocken über Stühle, Tische und geputzte Tafeln fielen, und einmal mehr machte mich der Anblick des stillen Gebäudes in den Ferien oder am Wochenende beklommener, als er es zu Unterrichtszeiten getan hatte […]«. Dass diese ‑mittlerweile wohl üblich geworden zu sein scheinende- Sprachverhunzug der im Deutschen logisch leider unmöglichen und daher falschen Konstruktion des »einmal mehr« (von dem aus dem Englischen schlampig übertragenen ‘once more’) dem oder der Suhrkamp-Lektor/in nicht weiter aufgefallen ist, lässt die Frage aufkommen, ob es überhaupt ein Lektorat gegeben hat, das Buch ist ja, wie gesagt, nun nicht gerade lang, da kann man sowas eigentlich nicht überlesen.
(Ein anderes Beispiel: Ob man bzw. Walter, er ist nach dem Krieg wieder auf dem Weg zu seiner Familie, das Strassenbahnschrillen beim Betätigen der Klingelschnur als »Klingelton« bezeichnet hat, halte ich für mindestens fragwürdig; ich denke bei diesem Begriff an neuzeitliche Mobiltelefone, aber vielleicht irre ich und man hat tatsächlich schon damals von Klingelton in dem Zusammenhang gesprochen).
Dies ist, soweit ich das überblicke, die erste kritische Rezension des Buches, weit und breit lese ich nur Jubelarien. Mich macht es ehrlich ratlos, dass dieses Buch »eines der herausragenden Bücher des Jahres« (Kegel, FAZ) sein soll.
Vielen Dank Wolfgang B für dieses sehr genaue Lesen. Das mit dem Klingelton war mir auch aufgefallen. Die Kälte Walters in der Hinrichtungsszene soll wohl mit den »kalten« Augen der Mutter bei der Begegnung nach dem Krieg in Essen korrespondieren. Dieses Motiv führte mich fast an Hanekes »Das weiße Band«, in dem die rohe Kälte eines Dorfes um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin exemplarisch für die Verrohung unter den Nazis später assoziiert wird. Aber vielleicht ist das sehr weit hergeholt.
100% d’accord was die Ambitionen angeht, die man fast mit Händen glaubt greifen zu können. Meine These über die Jubelarien geht dahin, dass wir getreu dem Text von Schirrmacher seinerzeit zu »Unsere Mütter, unsere Väter« in eine neue »Phase der Aufarbeitung« der NS-Zeit auch und nicht zuletzt ästhetisch gekommen zu sein scheinen. Das müsste man mal genauer untersuchen.
Um Himmels Willen, ich erinnere mich noch sehr gut daran, was dieses filmische Machwerk damals bewirkt hat, ein gewisser Arnulf Baring nämlich saß völlig aufgekratzt in einer den Film diskutierenden Sendung und faselte etwas von der Umkehrung von Opfer und Täter in Bezug auf die Juden, was ihm (auch) durch die spezielle Ästhetik dieses Films deutlich geworden sei. Dass Schirrmacher diese Art der Relativierung nicht erkannt hat, spricht nicht gerade für ihn. Es kann aber auch sein, dass es ihm vor allem auf den ultimativen Zeitpunkt ankam, an dem noch Zeitzeugen in der Familie für diese Diskussion zur Verfügung standen. Es war ja bei diesen Debatten immer ganz emphatisch. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass sich diese Art der Ästhetik durchsetzt und Deutungshoheit gewinnt.
Ich glaube, Schirrmacher meinte das nicht relativierend in Bezug auf die Täter und deren Handlungen. Aber Rothmann macht das, was in dem Film auch ansatzweise vorkommt und was vielleicht »die neue Sicht« genannt werden könnte: Die Generation der 1925ff geborenen als Verführte darzustellen, die am Ende von den Ereignissen und Verstrickungen, sofern sie sie überlebt haben, traumatisiert waren bis zum Tode – natürlich nebst fast obligatorischem Schweigen. Das ist, was die aktuellen Kriege bspw. in Afghanistan angeht (in den USA auch Vietnam) absoluter Standard. In Deutschland war es aber nach 1945 – aus vielen Gründen – tabuisiert, da noch lange Zeit der Revisionismus von rechts drohte.
Man denke sich nur Ödön von Horváths »Jugend ohne Gott«. In dem Roman verzweifelt der Lehrer daran, dass die Jugend der Zeit nur noch die NS-Indoktrination kennt. Die Gefahr dieser Betrachtung liegt darin, dass man dies berücksichtigend am Ende als Entschuldigung für die Verbrechen heranzieht bzw. nur die Vätergeneration, also die knapp vor bzw. um 1900 geboren als Täter sozusagen heranzieht. Damit wäre die nachfolgende Generation quasi »entlastet« und das fast unabhängig von ihren Taten. Das kann aber so nicht sein.
Aber das aus diesen Jahrgängen auch eine Unzahl von Menschen hervorgegangen sind, die die Bundesrepublik als Demokratie aufgebaut haben – und sei es nur als Sühne (still gelebt oder eben nicht), das gehört ja auch dazu.
Insofern muss ich gestehen, dass mich Walter Urban in der Form, wie dies hier erzählt wird, nicht die Bohne interessiert. Er erlebt Schrecknisse in den letzten Kriegsmonaten, wird dann Melker und später 30 Jahre Hauer. Das ist im wesentlichen die Geschichte, die erzählt wird. Und dann eben dieser Kitsch, der die Form des Romans sozusagen retten soll, aber eben m. E. abstürzen lässt.
Daneben?
Ist ja womöglich komplett falsch, aber zum zweiten Mal fällt mir in dem Zusammenhang der in diesen Belangen ja immer noch für Viele ästhetisch uk gestellte Ernst Jünger und seine famose Désinvolture ein.
Also entsprechend bei dem Protagonisten so etwas wie eine War-schlimm-aber-geht-mich-weiter-nichts-an-Haltung: Ich distanziere mich, um einerseits weiterzuleben … und mit dem angehäuften Schweigen eine Dimension des Unsagbaren anzureichern, aus dem der Autor erzähltechnisch dann ein beliebig zu fragmentierendes oder auszuwalzendes Geschehen machen kann.
(Der Zynismus ist hier nicht beabsichtigt, er unterläuft mir eher. Oder? Aber man denke an Littell: Es ist einfach ein in jeder Beziehung leicht auf Abwege führender Stoff.)
Der im Nachhinein draufgeschaffte Helmut Lethen – als Anleitungsfaden auch zur erzählerischen Bewältigung? Und dass in diesen Unschärfeverhältnissen sozusagen auch der Kitsch unterläuft: Als gäbe es da mit den schon viel zu vielen gehörte Stimmen, Einredungen, denen man auch als hellhöriger Autor nie mehr ganz entkommen kann?
***
Noch zum Klingelton: Selbst wenn das Straßenbahngeräusch damals so hätte genannt werden können, wäre das mit dem Beiklang heute als Wort dafür daneben.
Jünger ist für den 1. Weltkrieg ja so etwas wie ein Berichterstatter gewesen. Er war fasziniert vom Krieg als Kampf Mann gegen Mann, eine Art »Sport«. Döblin nannte das mal eine aristokratische Sicht auf den Krieg. Wenn man die »Stahlgewitter« liest, bemerkt man, wie Jünger diesen mannhaften Kampf vermisst und bedauert, dass nun alle Formen von Maschinen eingesetzt werden. In den 40er Jahren wähnte er sich intellektuell unabhängig und überlegen von den Nazis mit denen er nur ganz am Anfang sympathisierte. Seine Haltung konnte er recht gut kultivieren, nachdem er in höchsten Nazi-Kreisen praktisch Narrenfreiheit genoss. Aber dieser Krieg war nicht »sein« Krieg, weil es – mindestens im Osten – ein Vernichtungskrieg war, was ihn wohl anwiderte. Die »Marmorklippen« als Widerstandsbuch fand ich übrigens immer schon lächerlich (auch hier: Elemente des Kitsches). Aber er konnte sich zurückziehen. Die Tagebücher sind dann wieder interessanter.
Bei Littells »Wohlgesinnten« habe zumindest ich den Fehler gemacht, diesen Text sozusagen für bare Münze, bzw. wahrhaftig zu nehmen. Das war aber zu hoch gegriffen. Das Buch war eine Mischung aus Zynismus und Provokation, in etwa so eine gequirlte Scheiße wie die Filme von Tarantino (wobei ich sofort gestehe, nur einen Tarantino-Film zu Ende gesehen zu haben; zwei weitere hatte ich abgebrochen). In dem man nun in der FAZ (»Reading Room«) in seriösem Timbre von Christian Berkel vorgetragen einige Kapitel wie von der Kanzel vorgetragen hörte, verfiel das Feuilleton (und nicht nur das) in dem Glauben, hier liege ein wichtiges Vergangenheitsbewältigungswerk vor (erstaunlicherweise hatte Iris Radisch das durchschaut). Und ja, vielleicht liegt hierin die Parallele zwischen Littell und Rothmann.