
Jens Dittmar: So kalt und schön


Am 13. März 1920 besetzte der Reichswehrgeneral Walther von Lüttwitz, Kommandant der Marinebrigade Ehrhardt, die laut Regierungsbeschluss vom 29. Februar 1920 aufgelöst werden sollte, das Berliner Regierungsviertel und ernannte den deutschnational gesonnenen Beamten Wolfgang Kapp zum Reichskanzler. Die Regierung (eine Koalition aus SPD, den konservativen Zentrum und der liberalen DDP) floh zunächst aus Berlin nach Süddeutschland. Die Unterstützung war trotz der zum Teil frustrierten Reichswehr nicht breit genug. So schreibt Golo Mann beispielsweise über die »ironisch-neutrale« Stellung General von Seeckts: »…man würde sehen, wie weit Kapp käme«. Der Putsch scheiterte nach fünf Tagen. Zum einen verweigerte die Berliner Ministerialbürokratie den Putschisten ihre Unterstützung. Noch hielt also eine gewisse Loyalität der fragilen Weimarer Republik gegenüber. Zum anderen rief der SPD-Vorsitzende Otto Wels zu einem Generalstreik aus, dessen Folgen etwaige Sympathisanten der Putschisten zutiefst verunsicherte.
Der Kapp-Putsch ist weniger im Gedächtnis der Deutschen geblieben als der 1923 initiierte Hitler-Putsch, der am 8. November 1923 die bayerische Regierung für abgesetzt erklärte. Auch dieser Putschversuch scheiterte nach wenigen Tagen, die Polizei kämpfte ihn blutig nieder. Auch hier also eine Loyalität den Institutionen des Staates gegenüber. Dies war erstaunlich genug, denn Deutschland drohte bereits damals im Bürgerkrieg zu versinken.
Live-Ticker statt Extrablatt
Es ist nicht Zweck dieses Textes die historischen Implikationen nochmals zu beleuchten; das haben klügere Köpfe schon ausgiebig getan und werden es weiter tun. Und natürlich sind Parallelen oder gar Vergleiche immer mit Vorsicht zu genießen. In Anbetracht der Bilder aus der Ukraine und der Eskalation im Osten des Landes lässt mich aber eine Frage nicht mehr los: Was wäre eigentlich gewesen, wenn es zu Zeiten des Kapp-Putsches (oder auch des Hitler-Putsches) schon die heutige mediale Begleitung gegeben hätte? Wären diese Staatsstreiche dann vielleicht anders verlaufen? Gar erfolgreich?
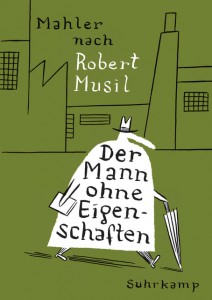
Kann man den Mann ohne Eigenschaften, Robert Musils unvollendeten Tausend-Seiten-Roman, dem ungefähr ebenso viele Seiten unveröffentlichter Abschnitte und diverser Bruchstücke zur Seite stehen, auf einige wenige Sätze reduzieren? Mit rhetorischer Besorgtheit stellen die Rezensenten von Nicolas Mahlers Comic-Adaptierung des Werks diese Frage. Sie ist falsch gestellt, denn natürlich kann man. Die dahinter stehende Frage ist, ob man darf. Und weil nun schon seit Jahrzehnten sowieso alles geht, darf man (ebenso natürlich). Bleibt also nur die Rhetorik, um die auch wir nicht herumkommen.
Mahlers graphic novel, sein Comic (auch im wörtlichen Sinn), bringt nur wenige Sätze aus dem Roman, die Geste des Autors ist dabei schnippisch oder patzig, etwa in dieser Bedeutung: »Da habt ihr halt wieder so ein Sätzchen von unserem berühmten Mann.« Die Essenz dieser Sätze drückt der Graphiker auf Seite 61 des Comics aus, indem er die drei Sprechblasen der drei Figuren im Salon Diotimas, wo die berühmte Parallelaktion ausgeheckt wird, leer läßt. Alles nur Blabla, es wird nichts geschehen, so lautet offenbar die Interpretation Nicolas Mahlers; die Parallelaktion ist ein fake. Fragt sich, ob seine Interpretation triftig ist. Musils Absichten entspricht sie nicht, der plante nämlich, den Roman mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs enden zu lassen, was die zeitliche Bewegung der ersten beiden der Bücher, in die der Roman unterteilt ist, dem Autor ja fast aufzwingt: die Handlung vollzieht sich unmißverständlich im Jahr 1913 und bricht dann Monate vor dem Sommer des Folgejahres ab. Die scheinbar so zögerliche, der Propaganda nach friedfertige Parallelaktion – Franz Joseph II. soll als »Friedenskaiser« gefeiert werden – trägt ihr Scherflein zur europäischen Katastrophe bei. Deshalb nun die Frage: Läßt sich der hier nur kurz angedeutete Gehalt des Romans durch leere Sprechblasen, die witzig wirken mögen in den hohen Räumen des Salons, auf den Punkt bringen?
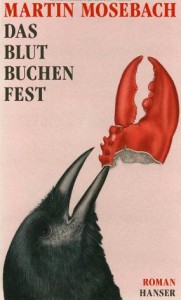
»Das Blutbuchenfest« von Martin Mosebach ist nicht nur ein Roman, sondern auch fast schon ein Film. Man sieht die Bilder schon vor sich: Den inszenierten Manierismus à la Peter Greenaway. Moderationen wie bei »Leo’s«. Und – das Lokal der Figur Merzinger, in dem die karikierte Upperclass-Clique des Romans ein- und ausgeht: das »Rossini« von Helmut Dietl, zumal die »mörderische Frage, wer mit wem schlief« auch hier nicht ganz unwichtig ist, obwohl es dann doch nicht sehr verwirrend ist.
Mit Nonchalance wird der Leser in diese Gesellschaft eingeführt: Da ist ein gewisser Wereschnikow, den man sich vielleicht als jüngeren Leonid Breschnew vorstellen kann; ein ziemlicher Aufschneider (mit einem nur ihm bekannten kleinen Vermögen in der Schweiz), dessen Ruhm sich primär darauf gründet mit Kissinger oder Boutros-Ghali zu telephonieren und, fast noch interessanter für den Zirkel: er ist der offizielle Lebenspartner der schönen Maruscha, deren Charakterisierung als Edelprostituierte unterkomplex und ein bisschen spießig wäre. Allzu verständlich ist doch, dass sie für ihre Maisonette-Wohnung länger schon die Mietzahlungen einstellend, auch die Erstattung der Nebenkosten als würdelosen weil allzu profanen Akt auffasst. Betroffen hiervon ist der Ex-Pleitier Breegen, ein etwas hüftsteifer Immobilienverkäufer und Pyramidenspieler, der sich zuletzt mit fünf Jahren seine Schuhe hat selbständig binden können, was ihn nicht daran hindert, Maruschas Liebhaber für bestimmte Nachmittage zu sein, währenddessen seine Frau sich mit dem Geschehen, welches sie mit Videokameras um ihr Grundstück herum beobachtet, vergnügt.
TAGEBUCHEINTRAG, 7. APRIL 1984
Über Gloggnitz + Schottwien in die Adlitzgräben hinauf – Richtung Breitenstein1, den Schildern zur »Speckbacherhütte« folgend. Der Bahnhof Breitenstein: renoviertes Gebäude, hier die zahllosen Ankünfte und Abreisen FW’s.2 Vorbei am Orthof (früher das Gasthaus von TOST, wie ich später erfahre, Tost wird von FW oft erwähnt, in den Briefen an Alma.) Ca. 1 km weiter, dann ein Schild Haus Milota, und eine Einfahrt führt zum Haus Mahler – keine Ähnlichkeit mit dem Haus von einst. Umbauten und Dazubauten haben das ganze äußere Erscheinungsbild grundsätzlich verändert, auch das schöne Dach ist nun Eternit-verscheußlicht. Herr Koçian begrüßt uns, in seinem dunkelblauen, sehr verschmutzten Arbeitsgewand, K. ist hier Hausmeister und –verwalter; der Daumen seiner rechten Hand ist bei einem Unfall abgetrennt worden, nur ein dicker Stumpf ist da noch übrig. K. führt uns durch die Küche hindurch, überall Abfall + Gerümpel + Zeug im Weg, die K.’s putzen das Haus, denn ab nächster Woche werden Werft-Arbeiter erwartet. Ein sehr dickes, sehr häßliches Kind mit Locken steht im Korridor, begrüßt uns kreischend. Wir sitzen in einem Anbau, ganz Resopal-Halle, Aufenthaltsraum für die Werft-Arbeiter – hier war einst der Eingang ins Haus, hier waren die schönen rosenumrankten Säulen.
In Breitenstein am Semmering, zwei Stunden Bahnfahrt von Wien entfernt, befand sich Alma Mahlers Ferienvilla, das 'Haus Mahler'. Gustav Mahler hatte das Grundstück 1910, ein Jahr vor seinem Tod, erworben. Zwei Jahre nach seinem Ableben begannen die Bauarbeiten. Franz Werfel (1890 – 1945) schrieb im 'Haus Mahler' in den Jahren 1919 bis 1938 die meisten seiner Werke. Siehe auch hier ↩
Ich recherchierte damals die Biografie des Dichters Franz Werfel, siehe "Franz Werfel – Eine Lebensgeschichte", S. Fischer Verlag, 1987 ↩
Geschichte kennt kein letztes Wort. (Willy Brandt)
Ein Riss ging durch deutsche Lande – von Travemünde bis zum einstigen Dreiländereck bei Hof. Über vierzig Jahre. Diese politische wie geographische Teilung trennte Menschen und Regionen. Entstanden war aber auch ein (fast) unbekannter Landschafts-Längsschnitt in beiden Deutschlands.

Das Naturschutzprojekt »Grünes Band« bewahrt einen Grüngürtel, einen Korridor durch stark zerstückelte Landschaft. Dabei handelt es sich um den so genannten Kolonnenweg auf der ehemaligen »Demarkationslinie« in einer Breite zwischen 50 und 200 Metern. Über Jahrzehnte hatte hier nur die Natur »Bewegungsfreiheit«. Es entstand eine Art Wildnis in einer sonst so intensiv genutzten landschaftlichen Umgebung: Brachflächen wechseln sich mit verbuschten Abschnitten ab, Altgrasfluren mit Wald, Flüsse mit Feuchtgebieten und Mooren.
»Es werde Stadt!« so der leicht pathetische Ausruf und Titel des Films von Dominik Graf und Martin Farkas. Die Stadt, die da werden soll, ist Marl im nördlichen Ruhrgebiet. Marl steht für Kohle, Chemie – und den Grimme-Preis. Und an Marl lässt sich die Geschichte des Ruhrgebiets sehr schön illustrieren: die Städtebauambitionen in den 1960er Jahren (als es mit der Kohleförderung schon schwieriger wurde, wenn auch eher unbemerkt), die viel gerühmte »insel« wie dort die Volkshochschule hieß. Es galt, wie es einmal heißt, Menschen zu »erziehen«. Und wenn es durch Bauwerke geschah (so sahen sie auch aus). Die offene, »radikal innovative« »Sharoun-Schule«, die, so ein Lehrer, erst in der Zeit als es die Gesamtschule gab, angenommen wurde. Was immer das bedeutet.
Graf und Farkas zeigen Aufstieg und Niedergang des Ruhrgebiets anhand der Stadt Marl und, allegorisch, parallel zur Entwicklung des Fernsehens. Die üblichen Klagen bei den befragten Bürgern: In Marl gebe es nichts, wo man abends hingehen kann. Der Niedergang des Fernsehens, wie ihn Graf und Farkas verstehen, symbolisiert sich am verrottenden Hallenbad Marls. Man braucht nur wenig an den Aussagen der Bürger über ihre Stadt ändern: Da gibt es nichts, was man abends einschalten kann.
[...] Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt die Geschichte von Ferdinand Goldberger mit großer sprachlicher Genauigkeit. Dabei spielt es für den Leser keine Rolle, dass »Schwarzer Flieder« eine Weiterführung der »Goldberger-Saga« des Autors ist, die 2009 mit »Magdalenaberg« begann, dann 2012 mit dem umfangreichen Roman »Roter Flieder« fortgesetzt wurde und hier – scheinbar – sein Ende findet (der ...