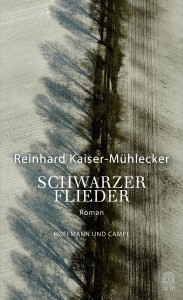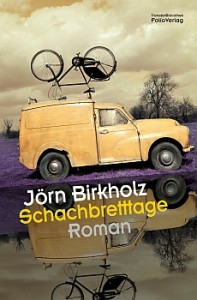TAGEBUCHEINTRAG, 7. APRIL 1984
Über Gloggnitz + Schottwien in die Adlitzgräben hinauf – Richtung Breitenstein1, den Schildern zur »Speckbacherhütte« folgend. Der Bahnhof Breitenstein: renoviertes Gebäude, hier die zahllosen Ankünfte und Abreisen FW’s.2 Vorbei am Orthof (früher das Gasthaus von TOST, wie ich später erfahre, Tost wird von FW oft erwähnt, in den Briefen an Alma.) Ca. 1 km weiter, dann ein Schild Haus Milota, und eine Einfahrt führt zum Haus Mahler – keine Ähnlichkeit mit dem Haus von einst. Umbauten und Dazubauten haben das ganze äußere Erscheinungsbild grundsätzlich verändert, auch das schöne Dach ist nun Eternit-verscheußlicht. Herr Koçian begrüßt uns, in seinem dunkelblauen, sehr verschmutzten Arbeitsgewand, K. ist hier Hausmeister und –verwalter; der Daumen seiner rechten Hand ist bei einem Unfall abgetrennt worden, nur ein dicker Stumpf ist da noch übrig. K. führt uns durch die Küche hindurch, überall Abfall + Gerümpel + Zeug im Weg, die K.’s putzen das Haus, denn ab nächster Woche werden Werft-Arbeiter erwartet. Ein sehr dickes, sehr häßliches Kind mit Locken steht im Korridor, begrüßt uns kreischend. Wir sitzen in einem Anbau, ganz Resopal-Halle, Aufenthaltsraum für die Werft-Arbeiter – hier war einst der Eingang ins Haus, hier waren die schönen rosenumrankten Säulen.
Weiterlesen
In Breitenstein am Semmering, zwei Stunden Bahnfahrt von Wien entfernt, befand sich Alma Mahlers Ferienvilla, das 'Haus Mahler'. Gustav Mahler hatte das Grundstück 1910, ein Jahr vor seinem Tod, erworben. Zwei Jahre nach seinem Ableben begannen die Bauarbeiten. Franz Werfel (1890 – 1945) schrieb im 'Haus Mahler' in den Jahren 1919 bis 1938 die meisten seiner Werke. Siehe auch hier ↩
Ich recherchierte damals die Biografie des Dichters Franz Werfel, siehe "Franz Werfel – Eine Lebensgeschichte", S. Fischer Verlag, 1987 ↩